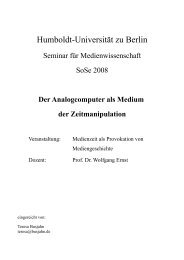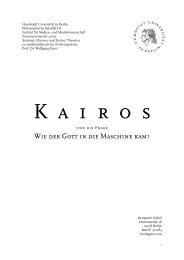Medienarchäologie den Test von Medientheorien am Material, und<strong>das</strong> heißt: an den Materialitäten der Kultur, ihre Technikenund Hardware.Medientheorein ihrerseits meint einen dezidiertarchäologischen <strong>Blick</strong>. Was ist <strong>das</strong> Archäologische daran? Zumeinen der Moment des Reflexivwerdens der Medien selbst, alsohistorisch-kulturelle Ereignisse analog zu Giambattista VicosDefinition von selbsterzeugter Menschheitsgeschichte insymbolischen Systemen. Ferner meint Archäologisierung dieSuspendierung des Diskursiven für einen Moment, also derVersuch, den nüchternen <strong>Blick</strong> auf mediale Konstellationennicht vorschnell an kontextuale Einbettung zu koppeln. EinInnehalten also, um nicht etwa kulturwissenschaftlichFunktionen und Effekte des Archivs mit denen eines kollektivnebelhaften Gedächtnisbegriffs zu verwechseln. Es geht also umden passionslosen Einblick in sowohl apparative wiekulturtechnische Abläufe, die illusionslose Einsicht desMenschen in seiner medialen Verstricktheit, doch ebenso - ganzim <strong>Sinn</strong>e jener Disziplin Archäologie, die auch im hiesigenFakultätsinstitut vertreten ist - die materialnaheEinsichtnahme. Oder - um einen Begriff Ernst Jüngersaufzugreifen - es geht um ein „zweites Bewußtsein“ von Kultur- nämlich Medienkultur.Sehr konkret war dies für die Photographie definiert worden,als der französische Astronom Jules Janssen 1882 diephotographische Platte als die „eigentliche Netzhaut desGelehrten“ bezeichnete - eine naturwissenschaftliche Ästhetik.Hier tritt - im aktiven <strong>Sinn</strong>e - Medienarchäologie an dieStelle der Phänomenologie; aisthesis an die Stelle derÄsthetik. 4Walter Benjamin schreibt in seiner Kleinen Geschichte derPhotographie 1931: „Es ist ja eine andere Natur, welche zurKamera als welche zum Auge spricht; anders vor allem so, <strong>das</strong>san die Stelle eines vom Menschen mit Bewußtsein durchwirktenRaums ein unbewußt durchwirkter tritt.“ Sigmund Freudseinerseits glaubt, daß im psychischen Apparat dem Bewußtseinjene „Negative“ verbogen bleiben, welche nicht zum„Positivprozess zugelassen“ werden. Hier prägt ein Leitmediumdie Metaphorik des Bewußtseins, wie auch für den historischenDiskurs (ein Wissen der Vergangenheit, quasi archäologischverborgen, <strong>das</strong> erst vom Historiker entwickelt wird). ImUnterschied von “latent" und "manifest“ liegt auch dietechnische Differenz der photographischen Verfahren Daguerres(Daguerreotypie) und Talbots (Negativentwicklung).4Dazu Martin Stingelin (Rez.), Unvermutete Welten, über: Bernd Stiegler, Philologie des Auges. Diephotographische Entdeckung der Welt im 19. Jahrhundert, München (Fink) 2001, in: Basler Magazin Nr. 37 v. 14.september 2002, 10
Medienkultur bildet nicht länger nur ab, sie bildet ein„zweites Bewußtsein“ aus - analog zum Begriff der imagingsciences. „Wir aber stehen mitte im Experiment. Wir treibenDinge, die durch keine Erfahrung begründet sind“, schreibtErnst Jünger in Das abenteuerliche Herz, ca. 1930, und FrankSchirrmacher ergänzt: „als würden wir in den Maschinenraumblicken“ 5 . Im Anschluß, zugleich aber in Überbietung vonDiskursanalysen, deren blinder Fleck die Einsicht intechnische Medien darstellt, betont Medienarchäologie geradenicht <strong>das</strong> anthropologische tröstliche Beziehungsgefügezwischen einer technologischen Basis und ihrem wahrnehmungsundkulturgeschichtlichen Überbau, sondern derenDiskontinuitäten.Damit korrespondiert auch eine methodische Option, denn der„kalte <strong>Blick</strong>“ betrifft auch unser Verhältnis zum Modell derKulturgeschichte. <strong>Der</strong> kalte <strong>Blick</strong> schaut auf Historie aus derPerspektive des Archivs; er sieht also nicht die illusionäre,phantasmagorische Fülle vergangenen Lebens, sondern dieGegenwart dessen, was von ihr als Grundlage unseres Wissensübriggeblieben ist: die Spärlichkeit des Materials, dieLücken, diskrete Zustände, die mit dem korrespondieren, was inden digitalen Medien längst wirkungsmächtig geworden ist.Diskrete Medien vermögen also <strong>das</strong> auszudrücken, was wir nicht- oder nur stammelnd - aussprechen können, im Medium derSprache: diskrete Rarität der Daten als Aussage der Historie.Und was die Kamera in diskreten Serien von frames aufzeichnet,ist nicht auf Sichtbarkeit, sondern Speicher- undÜbertragbarkeit ausgerichtet.Das moderne Projekt der (philosophischen) Aufklärung war immerschon an die Metapher des <strong>Blick</strong>s gekoppelt - aber eben nur alsphilosophisch-archäologische Metapher; erst militärtechnischwurde Aufklärung real. Dem abendländischen Diskurs, der seitAlt-Griechenland die Evidenz des Wahren an <strong>das</strong> Organ desAuges, der Augenzeugenschaft gekoppelt hat und in der <strong>Blick</strong>-Metaphorik des Frontizpizes der Encyclopédie d´Alemberts undDiderots gipfelte, stand bald ein Zweifel an derUnmittelbarkeit optischer Eindrücke gegenüber (David Hume,John Locke); dies führt zu einer Abkehr von der Aufklärung undVerlagerung vom optischen zum kognitiven Pardigma (DeutscherIdealismus). Auf diese Krise antwortet die Photographie mitdem diskursiven Effekt der unverfälschten Einschreibungoptischer Eindrücke, und <strong>das</strong> Genre des Dokumentarfilms 6 - dermedienarchäologische <strong>Blick</strong> als apparative Funktion / Fiktion.„<strong>Der</strong> bergsonschen Genealogie des `Sehvermögens´ entsprechend,kommt man zur Hypothese, <strong>das</strong>s die Bildtechnologien nicht <strong>das</strong>5Frank Schirrmacher, Die große Angst. Im Maschinenraum der Kultur, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 5v. 7. Januar 2003, 316Siehe <strong>das</strong> Kapitel über Video und Widerstand in Critical Art Ensemble, The Electronic Disturbance, New York1994; im Internet unter http://www.criticalart.net; dt. vonRobin Cackett und Carsten Does unterwww.hybridvideotracks.org
- Seite 1 und 2: KALTER SINN. DER MEDIENARCHÄOLOGIS
- Seite 6 und 7: Auge reproduzieren, sondern die sub
- Seite 8 und 9: Foucault fragt, "in welchen Formen,
- Seite 10 und 11: Nur die Methode selbst in sachliche
- Seite 12 und 13: Die endliche Menge alphabetischer Z
- Seite 14 und 15: er den un-menschlichen Blick hat. H
- Seite 16 und 17: sich seine Erkenntnismetapher von d
- Seite 18 und 19: not have any type of similarity wit
- Seite 20 und 21: unmißverständlich: Cybernetics or
- Seite 22 und 23: Bezug zum Objekt verweigert, im Geg
- Seite 24 und 25: Genozids vor allem aus der Perspekt
- Seite 26 und 27: wird, um Unerwartetes signaltechnis
- Seite 28 und 29: Alte Holzschnitte wie moderne Comic
- Seite 30 und 31: zugleich auf das gewöhnliche und n
- Seite 32 und 33: ecourent volontiers au regard de l
- Seite 34 und 35: unersättlich. Beschrieben wird hie
- Seite 36 und 37: logophil) entzogen. Steuermedium di
- Seite 38 und 39: Verbale Markierungen werden in herm
- Seite 40 und 41: gesellschaftlichen Zustandes den ga
- Seite 42 und 43: Moment der Dämmerung: „Wenn für
- Seite 44 und 45: mit der kléa andrón ein, „von M
- Seite 46 und 47: erst mit Techniken wie Leon Battist
- Seite 48 und 49: Giesecke die frohe Botschaft einer
- Seite 50 und 51: Informationseinheit (bit). Im typog
- Seite 52 und 53: Erste Bilder aus (geometrischen) Da
- Seite 54 und 55:
und der Penetrationskonflikt der Ze
- Seite 56 und 57:
Essens der elektronischen Bildabtas
- Seite 58 und 59:
jeder illustrierten Zeitung zu find
- Seite 60 und 61:
Dehnung der Zeit, das Intervall. De
- Seite 62 und 63:
Besorgnis schreibt sich dieser Blic
- Seite 64 und 65:
edeutendes Ereignis, das nicht auch
- Seite 66 und 67:
aristotelsichen Mediendefinition hi
- Seite 68 und 69:
Film / Kino-AugeDer medienarchäolo
- Seite 70 und 71:
Ich bin Kinoglaz. Ich bin ein mecha
- Seite 72 und 73:
Andersons Resident Evil (USA/GB/D 2
- Seite 74 und 75:
Ernst Jüngers Begriff vom „zweit
- Seite 76 und 77:
Perseus trotzt in der griechischen
- Seite 78 und 79:
Eher im analytisch-messenden denn i
- Seite 80 und 81:
Medien der Universität: Sprache, T
- Seite 82 und 83:
Kommen wir zurück auf jenen Wahrne
- Seite 84 und 85:
Was uns hier vorgeführt wird, ist
- Seite 86 und 87:
nichts als den Informationswert (de
- Seite 88 und 89:
Lange, langsame Einstellungen sind
- Seite 90 und 91:
Mittelalter die tatsächlich gespie