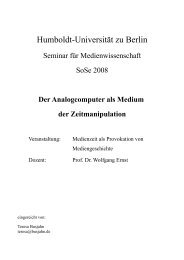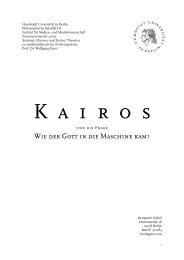Kalter Sinn. Der medienarchäologische Blick, das ...
Kalter Sinn. Der medienarchäologische Blick, das ...
Kalter Sinn. Der medienarchäologische Blick, das ...
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mit der kléa andrón ein, „von Mund zu Mund“ (zu Ohr, nicht zumAuge). Kléos gehört zu klúo, „hören“; zu unterscheiden von aíooder akoúo. Letztere bezeichnen <strong>das</strong> akustische, physiologischeWahrnehmung einer Stimme oder eines Klanges, der ans Ohrdringt, „während kléo stets auf den Inhalt des Gesprochenenzielt“ 106 - analog zum Unteschied zwischen scannen undIkonologie im Reich der Bilder. Entsprechend meint akoé „<strong>das</strong>Gerücht, nicht die Sache“ . Allerdings gleichen sichschon bei Homer beide Bedeutungen einander an (metonymisch imNamen der Muse Klio). Im Proömium zum Schiffskatalog im II.Gesang der Ilias appelliert Homer an die Musen: kléos oionakoúomen, „wir haben nur die akoé“, und dem wird mit párestete íste te panta <strong>das</strong> Wissen der Augenzeugen gegenübergestellt“. Demgegenüber eröffnet Lektüre die Möglichkeit desmedialen Sehens: "Ist <strong>das</strong> Schreiben ein ‘Schildern’, wird <strong>das</strong>Lesen zum ‘Betrachten’" .Tatsächlich aber wiederholt sich in der mikroskopischenLektüre noch einmal die Erfahrung des makroskopischen <strong>Blick</strong>s:die Entfernung. <strong>Der</strong> operative Akt des Lesens prozessiert hierauf medienarchäologischer Ebene <strong>das</strong>, was kognitiv alshistorischer Raum verarbeitet wird: ”However strong theillusory presence of the fiction, as readers we can neverliterally participate in the narrated action; nor on the otherhand, are we vulnerable to the dangers in which it mightinvolve us in reality." 107 Jede Lektüre wird so zum Akt einerunmöglichen Einbildung. Horst Wenzel weist darauf hin: Was dieGriechen fantasia nennen und die Römer visiones,‚repräsentiert‘ die Bilder abwesender Dinge, ”so daß wir siemit den Augen zu erkennen und gegenwärtig zu haben scheinen”(Quintilian VI. 2,29).<strong>Der</strong> kalte <strong>Blick</strong> der mediävistischen Philologie identizifizertfür Texte frühmittelalterlicher Annalistik anonyme „Hände“,keine Autoren. Dieses Genre registriert kontingenteEreignisfolgen als chronologische Listen, nicht Erzählungen:Jede Distanz sei es die eines Tages oder die eines Tagesmarsches von einem Dorf zum anderen fügt dennackten Feststellbarkeiten einen Bedarf an Auslegung hinzu; Mangel an Auslegung manifestiert sich in derniedersten aller Formen, der der Aufzählung. 108Diese Ästhetik kehrt unter verkehrten medientechnischenVorzeichen um 1800 zurück, als sich Kritik an verführerischer,überredender Rhetorik zugunsten einer administrativenStaatsschrift artikuliert. Stimme und Wortpracht des Autorskann der Leser nicht fassen, „und kann seinen Mann so oft undmit kaltem Blut überlesen, daß er ihm hinter die Künste106Tilman Krischer, Mündlichkeit und epischer Sänger im Kontext der Frühgeschichte Griechenlands, in:Kuhlmann / Reichel (Hg.) 1990: 51-64 (57)107A. C. Spearing, The Medieval Poet as Voyeur. Looking and Listening in Medieval Love Narratives.Cambridge (Cambridge U. P.) 1993, 28108Hans Blumenberg, zitiert in: Florian Felix Weyh, Das Jahr Laplace, in: Lettre international, Heft 47 (1999),116-123 (121)