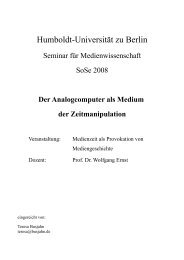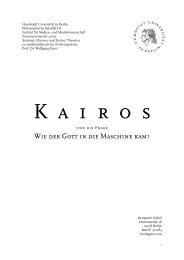Lange, langsame Einstellungen sind charakteristisch für denfilmischen Topos der Abschiede. <strong>Der</strong> kalte <strong>Blick</strong> der Hollywood-Industrie verhandelt zwar emotions, aber jeder Moment istdurchkalkuliert nach dem industriellen Muster von Kameraschuß/ Gegenschuß. Genau dies macht solche Filme so(computer)berechenbar. <strong>Der</strong> kalte <strong>Blick</strong> der Hollywood-Skripte(durchökonomisierte Bilder der Subjektproduktion)korrespondiert hier mit Optionen der elektronischen Ordnungeben dieser Bilder. Evident ist dies dem wiederum kalten,scharfen <strong>Blick</strong> der Filmanalytiker im Unterschied zumsemantischen <strong>Blick</strong> des Kinopublikums. Erst die Einführung desAufzeichnungsmediums Video aber machte solche Filme denKritikern zuhause wie vormals literarische Produkte derBuchkultur nachsichtbar (also sehen sie gar nicht Film,sondern schreiben Videokritiken).Im Diesseits von Musik: AkustikJonathan Crary interpretiert die Architektur desFestspielhauses von Bayreuth als bewußt geplante Ausrichtungdes <strong>Blick</strong>s der Zuschauer durch Richard Wagner - theoría alsDispositiv. Dem wäre eine Interpretation entgegenzusetzen, dienicht sieht, sondern vor allem hört. Dem kalten <strong>Blick</strong> geselltsich <strong>das</strong> kalte Ohr zu, am Beispiel des einsetzenden Akt II vonWagners Oper Tristan und Isolde. „Mir schwand schon fern derKlang", äußert Isolde nach dem Abzug der Männer zur Jagd.Medium dieser Wahrnehmung , im Gegensatz zu aller Theaterpraxis vor Wagner, sind keine Augen, sondernOhren. <strong>Blick</strong>e, Masken, Erscheinungen nichits von alledem zählt mehr. Zum erstenmal hat eine Oper stattoptischer Handlungen, die Vokal und Instrumentalmusiken dann nurmehr begleiten würden, eine akustischeHandlung, die zum Drama selber aufrückt. <strong>Der</strong> Dialog zwischen Isolde und Brangäne kreist ja um die einzigeFrage, ob <strong>das</strong> Gehörte akustishe Wahrnehmung oder akustische Täuschung ist. Was Isolde „wonnigesRauschen“ oder „sanft rieselnde Welle“ eines „Quells“ nennt, greift dem Ingenieursbegriff Rauschquelle jaunmittelbar zuvor. Wagners Musik ist also eine Maschine . „Zu vernehmen, was du wähnst“, besagt sehrpräzise, die Grenze zwischen Kunst und Natur, im gegevenen Fall also zwischen Ventilhörnern undQuellgeräuschen systematisch zu ignorieren 220- wie den Gesang der Sirenen als Differenz von künstlicher undtatsächlich humaner Stimme.Audiovisuelle Medien adressieren menschliche Augen und Ohren.Während optische oder gar bildgebende Apparaturen denpassionslosen <strong>Blick</strong> auf Materie und Prozesse lehren, sind dieOhren empfindlich für Klang und damit der melancholischenErfahrung von Zeitablauf unterworfen. Homer gab im 12. Gesangseiner Odyssee ein Rätsel auf, als er den Helden amSchiffsmast angebunden und seine Ruderer mit wachsverstopftenOhren am verführerischen Gesang von zwei Sirenen220Friedrich Kittler, „Vernehmen, was Du wähnst“. Über neuzeitliche Musik als akustische Täuschung, in:Kaleidoskopien Heft 2 (1997), 8-16 (14)
vorbeischiffen ließ. Tatsächlich lassen sich Augen leichterverschließen als Ohren.Hören ist ein Fernsinn, jedoch von anderer Art als <strong>das</strong> Sehen. Sehend erblicken wir irgend etwas, nah oder fernvon uns, über einen Abstand hinweg. Im Hören fällt <strong>das</strong> Moment des Abstandes fort. Ob fern oder nah,identifizierbar als ein Rascheln, Läuten, Ton einer Geige oder eines Saxophons Ton dringt ein, ohne Abstand.Sehen und Tasten haben einen strukturellen Bezug zum Erkennenund Wahrnehmen, insofern die Lichtwellen etwa nichtunmittelbar in elektrochemische Reize verwandelt und demneuronalen Mechanismus weitergeleitet, sondern schon auf derNetzhaut gefiltert werden. Das Hören steht hingegen inDirektkontakt mit den Schwingungen der Materie.Solche Einsichten legen es nahe, Ästhetik in ein Maß derInformation zu verwandeln; Friedrich Nietzsche wollteidealerweise mit dem Ergographen die Erregungszustände desPublikums altgriechischer Dramen messen. <strong>Der</strong> Moskauer LehrerLeonard Bernsteins wiederum entwickelte eine Skala, mit dersich die Schönheit eines musikalischen Kunstwerks messenlassen sollte. Max Bense schließlich kalkuliert <strong>das</strong>ästhetische Maß als statisches Verhältnis negentropischerOrdnung.Pierre Boulez, vertraut durch zeitgenössische Komposition vonMusik mit elektronischen Mitteln, dirigierte einmal RichardWagners Götterdämmerung in Bayreuth - per aspera (die serielleMusik) ad astra? Niemand anders als Michel Foucaultidentifizierte dieses Durchlaufen einer Entwicklung in seinerKritik der Aufführung, der er am letzten Abend der BayreutherRing-Inszenierung beiwohnte:Es war, als hätte Boulez seinen eigenen Weg noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Es ist auch die ganzeBewegung des Jahrhunderts der modernen Musik, die, ausgehend von Wagner, durch <strong>das</strong> große Abenteuer desFormalen hindurch, wieder zur Intensität und zur Bewegung des Dramas fand. Die völlig dechiffrierte Formverwob sich mit dem Bild. 221Maurice Blanchot zufolge erinnert besonders der Gesang derSirenen Menschen an <strong>das</strong> Nicht-Menschliche ihres Gesangs. EineMensch-Maschine, oder <strong>das</strong> Mathematische an der Musik? Blanchotnimmt in seinem Text „<strong>Der</strong> Gesang der Sirenen“ (Original 1955)die Sirenen-Episode im 12. Gesang von Homers Odyssee als Frageüber <strong>das</strong> Wesen der Musik auf. „Zwar haben sie gesungen,aber auf eine Art, die nur die Richtung anzeigte, wo diewahren Quellen und <strong>das</strong> echte Glück des Gesangs entspringensollten.“ 222 <strong>Der</strong> Ursprung der Musik ist also nicht hörbar, undalle hörbare Musik nur <strong>das</strong> Anzeichen ihrer Quelle, wie im221Michel Foucault, Imaginationen des 19. Jahrhunderts, in: die tageszeitung (Berlin), Sonderausgabe, 11.Oktober 1980, 24f (25)222Maurice Blanchot, <strong>Der</strong> Gesang der Sirenen, in: ders., <strong>Der</strong> Gesang der Sirenen. Essays zur modernen Literatur,München (Hanser) 1962, 9-40 (11)
- Seite 1 und 2:
KALTER SINN. DER MEDIENARCHÄOLOGIS
- Seite 4 und 5:
Medienarchäologie den Test von Med
- Seite 6 und 7:
Auge reproduzieren, sondern die sub
- Seite 8 und 9:
Foucault fragt, "in welchen Formen,
- Seite 10 und 11:
Nur die Methode selbst in sachliche
- Seite 12 und 13:
Die endliche Menge alphabetischer Z
- Seite 14 und 15:
er den un-menschlichen Blick hat. H
- Seite 16 und 17:
sich seine Erkenntnismetapher von d
- Seite 18 und 19:
not have any type of similarity wit
- Seite 20 und 21:
unmißverständlich: Cybernetics or
- Seite 22 und 23:
Bezug zum Objekt verweigert, im Geg
- Seite 24 und 25:
Genozids vor allem aus der Perspekt
- Seite 26 und 27:
wird, um Unerwartetes signaltechnis
- Seite 28 und 29:
Alte Holzschnitte wie moderne Comic
- Seite 30 und 31:
zugleich auf das gewöhnliche und n
- Seite 32 und 33:
ecourent volontiers au regard de l
- Seite 34 und 35:
unersättlich. Beschrieben wird hie
- Seite 36 und 37:
logophil) entzogen. Steuermedium di
- Seite 38 und 39: Verbale Markierungen werden in herm
- Seite 40 und 41: gesellschaftlichen Zustandes den ga
- Seite 42 und 43: Moment der Dämmerung: „Wenn für
- Seite 44 und 45: mit der kléa andrón ein, „von M
- Seite 46 und 47: erst mit Techniken wie Leon Battist
- Seite 48 und 49: Giesecke die frohe Botschaft einer
- Seite 50 und 51: Informationseinheit (bit). Im typog
- Seite 52 und 53: Erste Bilder aus (geometrischen) Da
- Seite 54 und 55: und der Penetrationskonflikt der Ze
- Seite 56 und 57: Essens der elektronischen Bildabtas
- Seite 58 und 59: jeder illustrierten Zeitung zu find
- Seite 60 und 61: Dehnung der Zeit, das Intervall. De
- Seite 62 und 63: Besorgnis schreibt sich dieser Blic
- Seite 64 und 65: edeutendes Ereignis, das nicht auch
- Seite 66 und 67: aristotelsichen Mediendefinition hi
- Seite 68 und 69: Film / Kino-AugeDer medienarchäolo
- Seite 70 und 71: Ich bin Kinoglaz. Ich bin ein mecha
- Seite 72 und 73: Andersons Resident Evil (USA/GB/D 2
- Seite 74 und 75: Ernst Jüngers Begriff vom „zweit
- Seite 76 und 77: Perseus trotzt in der griechischen
- Seite 78 und 79: Eher im analytisch-messenden denn i
- Seite 80 und 81: Medien der Universität: Sprache, T
- Seite 82 und 83: Kommen wir zurück auf jenen Wahrne
- Seite 84 und 85: Was uns hier vorgeführt wird, ist
- Seite 86 und 87: nichts als den Informationswert (de
- Seite 90 und 91: Mittelalter die tatsächlich gespie