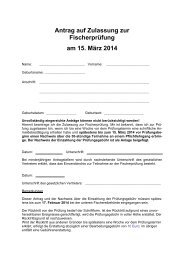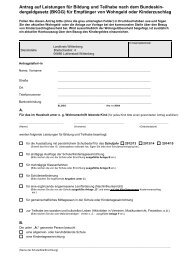Artenschutzprogramm in Sachsen - Publikationen - Freistaat Sachsen
Artenschutzprogramm in Sachsen - Publikationen - Freistaat Sachsen
Artenschutzprogramm in Sachsen - Publikationen - Freistaat Sachsen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1.3 Bestandsentwicklung<br />
Die Rekonstruktion der Bestandsentwicklung des Weißstorchs<br />
<strong>in</strong> <strong>Sachsen</strong> seit Beg<strong>in</strong>n des 20. Jahrhunderts bereitet e<strong>in</strong>ige<br />
Schwierigkeiten. Ursache hierfür s<strong>in</strong>d zum e<strong>in</strong>en die im Verlaufe<br />
des Jahrhunderts – <strong>in</strong>sbesondere im nördlichen und öst -<br />
lichen <strong>Sachsen</strong> – veränderten Landesgrenzen. Des weiteren<br />
gibt es große Erfassungslücken, vor allem aus der Zeit des<br />
2. Weltkrieges und <strong>in</strong> den Jahren danach. Und schließlich<br />
haben auch unklare Angaben zum Brutstatus (z. B. Bezeichnungen<br />
wie „besetzte und beflogene Nester“ oder die Addition<br />
von ehemals vorhandenen und noch besetzten Nestern)<br />
dazu geführt, daß die frühere Bestandsentwicklung nicht<br />
exakt nachvollzogen werden kann. Erst mit der Arbeit<br />
von SCHÜZ (1952) und der damit verbundenen Vere<strong>in</strong>heit -<br />
lichung der Bezeichnungen gelang e<strong>in</strong>e Verbesserung.<br />
Bestandsentwicklung vor 1950<br />
Der Brutbestand unterlag stets beträchtlichen Schwankungen,<br />
wobei zwischen kurzfristigen (z. B. „Störungsjahre“)<br />
und langfristigen Veränderungen zu unterscheiden ist. E<strong>in</strong><br />
Tiefpunkt wurde im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erreicht,<br />
nachdem es <strong>in</strong> <strong>Sachsen</strong> „vor zwei- bis dreihundert<br />
Jahren im Niederlande noch Störche genug gegeben hat“<br />
(DÖRFEL 1926). Westsachsen besaß 1906 10 besetzte Nester;<br />
1924 war der letzte Brutplatz <strong>in</strong> Malkwitz bei Oschatz<br />
verwaist (ZIMMERMANN 1933). Im Jahre 1928 umfaßte der<br />
Der Weißstorch <strong>in</strong> <strong>Sachsen</strong><br />
Tab. 4: Altkreise mit hohen Storchendichten (HPa/100 km 2 ) 1958 und 1999<br />
Regierungsbezirk Altkreis 1958 1999<br />
Dresden Großenha<strong>in</strong> 2,4 9,3<br />
Bautzen 3,3 8,1<br />
Niesky 3,1 6,9<br />
Leipzig Torgau 2,5 5,2<br />
Wurzen 2,3 4,8<br />
Eilenburg 1,4 4,1<br />
Abb. 9: Fliegender Weißstorch<br />
Foto: Archiv LfUG, R. Schipke<br />
sächsische Bestand nur 13 Brutpaare (DÖRFEL 1926, SCHOL-<br />
ZE & LIEBMANN 1930, GÜNTHER 1960/62). Die 1930er Jahre<br />
brachten e<strong>in</strong>en Bestandsanstieg mit dem Höchststand zwischen<br />
1934 und 1940. In Ostsachsen waren 1934 m<strong>in</strong>destens<br />
83 besetzte Nester zu verzeichnen (ZIMMERMANN<br />
1933), <strong>in</strong> Westsachsen m<strong>in</strong>destens 13 (ZIMMERMANN &<br />
BÖHMER 1941). Die Erfassungen <strong>in</strong> den Kriegs- und Nachkriegsjahren<br />
weisen die bereits erwähnten Lücken auf; der<br />
Bestand hielt sich jedoch trotz zusätzlicher kriegsbed<strong>in</strong>gter<br />
Verluste etwa auf dem Niveau der 1930er Jahre. GÜNTHER<br />
(1956), der sich mit dem Weißstorchbestand der Kreise Riesa<br />
und Großenha<strong>in</strong> nach 1945 befaßte, stellte dazu fest, „daß<br />
früher geäußerte Befürchtungen, der Storch werde bald aussterben,<br />
nicht begründet s<strong>in</strong>d“.<br />
Die Ursachen des zeitweilig starken Bestandsrückganges <strong>in</strong><br />
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren sowohl Verluste<br />
während des Zuges und im W<strong>in</strong>terquartier (Verfolgung<br />
durch den Menschen, Aufnahme vergifteter Heuschrecken,<br />
vgl. KLENGEL 1918, DÖRFEL 1926) als auch Bee<strong>in</strong>trächtigungen<br />
im heimischen Brutgebiet. Dazu werden Zerstörung<br />
des Lebensraumes (Bergbau, Entwässerung), Gefährdungen<br />
durch Elektroanlagen, Abschuß (Jagd, Abwehr von Fischereischäden<br />
[!], Kriegswirren), Niststättenmangel (Gebäudeabriß<br />
bzw. –modernisierung, Baumfällungen) und auch<br />
Kämpfe um den Nistplatz genannt. Zu diesen stellte jedoch<br />
bereits KLENGEL (1918) fest, daß sie ihren Grund offenbar<br />
nicht im Mangel an Niststätten haben, da es „ja auch zahlreiche<br />
leerstehende (geeignete) Nester im Lande gibt“.<br />
Bestandsentwicklung 1950 bis 1999<br />
Die Entwicklung der Weißstorchpopulation <strong>Sachsen</strong>s <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en<br />
derzeitigen Grenzen von 1950 bis 1999 ist <strong>in</strong> Abb. 10<br />
dargestellt. Die Werte bis 1957 s<strong>in</strong>d lückenhaft. Im Jahre<br />
1958 erfolgte e<strong>in</strong>e erste (vollständige) Bestandsaufnahme<br />
für das Gebiet der DDR (SCHILDMACHER 1960). Für die ersten<br />
Jahre nach 1958 konnten wiederum nicht alle Daten<br />
ermittelt werden, obwohl durch die sächsischen Weißstorchbetreuer<br />
versucht wurde, die Geschichten aller seit<br />
1950 bestehenden Nester zurückzuverfolgen. Der Brutbestand<br />
zeigt seit 1950 e<strong>in</strong>e stetige Zunahme. Im Jahre 1972<br />
erreichte er erstmals über 200 Nestpaare (HPa) und im Jahre<br />
1980 nisteten bereits 300 HPa <strong>in</strong> <strong>Sachsen</strong>. Seit 1995 weist<br />
der sächsische Bestand mit über 400 Nestpaaren und e<strong>in</strong>er<br />
Dichte von bis zu 2,42 HPa/100 km 2 (1996) e<strong>in</strong>e auch<br />
deutschlandweit bedeutende Charakteristik auf.<br />
15