Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Für eine politische Ethik des Raumes<br />
Philosophische Stichworte zu einer freien Baukultur<br />
Prof. Dr. Peter Sloterdijk<br />
Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe<br />
Es ist mir eine Ehre <strong>und</strong> ein Vergnügen, mit diesem eminenten<br />
Personenkreis einige Gedanken austauschen zu dürfen über die<br />
Frage nach dem Wesen Europas sowie über eine politische Ethik<br />
des Raumes – wobei ich fürs erste den Zusammenhang zwischen<br />
den beiden Themenmotiven im Unklaren lasse. Bevor ich zur<br />
Sache komme, muss ich nur dem Moderator noch kurz widersprechen.<br />
Es bricht keineswegs immer ein Konflikt los, wenn ich<br />
in der Öffentlichkeit etwas sage. Ich bin kein streitbarer Mensch.<br />
Nach meiner Selbstbeschreibung bin ich außerordentlich nett<br />
<strong>und</strong> fre<strong>und</strong>lich, aber meine Art von Nettigkeit wird chronisch<br />
missgedeutet – daher arbeite ich berufsmäßig daran, den hohen<br />
Missverständnisfaktor auf ein erträgliches Maß zu reduzieren –<br />
mit zweifelhaftem Erfolg, wie man sieht. Außerdem werde ich<br />
bei dem heutigen Vortrag ein wenig behindert sein, Nachklänge<br />
zu Herrn Vespers Ausführungen über die Gebührenordnung der<br />
Architekten werden mir im Kopf herumspuken. Während der<br />
ersten halben St<strong>und</strong>e meiner Ausführungen können Sie merken,<br />
dass ich in Gedanken anderswo bin. Ich bin fasziniert vom<br />
Hinweis auf konkurrierende Gebührenordnungen. Das hat mich<br />
in eine träumerische Stimmung versetzt, ich denke darüber nach,<br />
wie es wäre, wenn auch Philosophen Gebührenordnungen hätten<br />
<strong>und</strong> bei allen Allgemeinheiten, die andere Leute vorbringen, mitverdienten?<br />
Ich will Ihnen jetzt im voraus sagen, worüber ich heute spreche,<br />
damit sie überprüfen können, ob ich imstande war, mir mein<br />
Konzept zu merken. Ich möchte heute erstens ein Paar Gedanken<br />
über das alte Europa vortragen – <strong>und</strong> zwar mit der Tendenz,<br />
Europa als ein dramaturgisches Phänomen zu charakterisieren.<br />
Danach mache ich einige Andeutungen über die <strong>Architektur</strong> als<br />
eine Kunst der Immersion, das heißt des Eintauchens in<br />
Gesamtverhältnisse, <strong>und</strong> zum Schluss stelle ich eine zweite<br />
Europadefinition vor, die diesen Kontinent als ein umfassendes<br />
postimperiales Verwöhnungsprojekt beschreibt, an dem die<br />
Architekten als Agenten des Zeitgeistes unter dem Stichwort<br />
„Lebensqualität“ in besonderer Weise engagiert sind. Dass ich<br />
diesen Gedanken an den Schluss stelle, hat seinen guten Gr<strong>und</strong>,<br />
es wird mir das Entkommen erleichtern.<br />
Philosophen sind dafür berühmt, ihre Thesen weit herzuholen.<br />
Ich sage Thesen <strong>und</strong> nicht Meinungen, weil es Meinungen in<br />
unserem Beruf offiziell nicht gibt. Man hat die Philosophen ja<br />
definiert (vor allem in der nach-kartesischen Zeit) als Menschen,<br />
die einen Krieg gegen die Memorier, die Gedächtnismenschen<br />
führen. Für sie ist alles, was nur aus dem Gedächtnis stammt,<br />
von vorneherein falsch oder zumindest suspekt. Am liebsten<br />
wollen wir – oder einige von unserer Zunft – auf der tabula rasa<br />
der Gedächtnislosigkeit arbeiten, so wie ein Architekt auf einem<br />
leeren Blatt eine Skizze zeichnet. Wie jedes reale Haus auf einem<br />
leeren Blatt anfängt, so will auch der Philosoph auf einem leeren<br />
Gr<strong>und</strong> neu beginnen. Daher ist seit jeher ein gewisser pathologi-<br />
scher Menschentyp in philosophischen Angelegenheiten begünstigt,<br />
ich spreche von den Leuten, die sich wegen einer extremen<br />
Gedächtnisschwäche ihre eigenen Überzeugungen nicht merken<br />
können. Solche Individuen machen zuweilen die Entdeckung,<br />
dass man auf der Gr<strong>und</strong>lage reinen Nachdenkens anhand einer<br />
exakt abgezählten Anzahl von Axiomen <strong>und</strong> eines gesicherten<br />
Schlussverfahrens immer wieder dasselbe Ergebnis erzielt –<br />
wodurch tatsächlich Gedächtnis überflüssig wird. Ständiges<br />
Neudenken führt offenk<strong>und</strong>ig auch zum Ziel. Überzeugungen<br />
muss man sich nicht merken, sondern ständig neu ableiten.<br />
Philosophen wären demnach Meinungsarchitekten, die immer<br />
wieder vom Null-Punkt starten.<br />
Heute können wir uns das leider nicht leisten, weil hier eine<br />
Geschichte zu erzählen ist. Europa ist bekanntlich ein Eigenname,<br />
<strong>und</strong> Namen kommen nur in Geschichten vor, für deren<br />
Wiedergabe ein gewisses Maß an Gedächtnisanstrengung in<br />
Anspruch zu nehmen ist. Provisorisch schlage ich daher für die<br />
Tätigkeit des Philosophen eine zusätzliche Definition vor <strong>und</strong><br />
sage: Philosophie ist allgemeine Situationstheorie. Philosophieren<br />
heißt Situationen theoretisieren. Eine Situation ist sehr allgemein<br />
zu bestimmen als ein Verhältnis des Zusammenseins von<br />
Elementen. Die Faktoren dieses Verhältnisses zählen sich in folgender<br />
Weise auf: Situationen sind Formen des Zusammenseins<br />
von Jemand mit Jemand <strong>und</strong> Etwas in Etwas. Was heißt das? Die<br />
ersten beiden Figuren sind unmittelbar verständlich: Jemand mit<br />
jemand – das bezeichnet eine personale Assoziation oder ein pri-




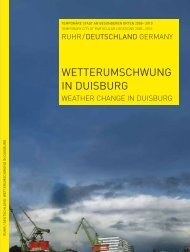
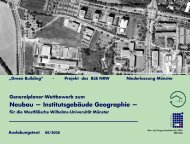





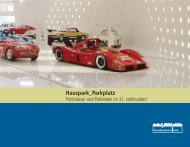




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)