Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang, an einen philosophischen<br />
Dialog des Dichters <strong>und</strong> Philosophen Paul Valéry aus dem<br />
Jahr 1921 zu erinnern: „Eupalinos oder der Architekt“. Hier<br />
werden zwei Gestalten der Antike heraufbeschworen, die wir aus<br />
dem corpus platonicum kennen, Sokrates auf der einen Seite,<br />
Phaidros auf der anderen. So ganz zufällig ist dieses Personal<br />
nicht gewählt, denn die beiden hatten in der Antike miteinander<br />
eine unvollendete Liebesgeschichte, so dass es plausibel scheint,<br />
sie unter veränderten Bedingungen noch einmal zusammentreffen<br />
zu lassen. Man erinnert sich: Phaidros war der einzige junge<br />
Mann, dem gegenüber Sokrates momentan die Kontrolle verlor,<br />
damals, in einer berühmten Passage des gleichnamigen Dialogs,<br />
in dem Sokrates bei einer Promenade außerhalb der Stadt einen<br />
Hauch von dionysischer Rührung verspürte – ein Zugeständnis,<br />
das Plato ansonsten nicht leicht zu machen bereit war.<br />
Ausgerechnet dieser Phaidros ist also zur Stelle, wenn es gilt,<br />
über <strong>Architektur</strong> zu reden. Und warum? Weil es beim Häuserbauen<br />
um ein Problem der Liebe geht – zumindest mittelbar <strong>und</strong><br />
hintergründig. Der Totalitarismus der <strong>Architektur</strong> ist ein<br />
Totalitarismus der Liebe, der Raumliebe, der Hingerissenheit<br />
durch das, was uns nicht nur gegenüber ist, sondern uns wie<br />
eine Hülle umgibt. <strong>Architektur</strong> artikuliert das (von Bachelard so<br />
genannte) topophile Gefühl, indem sie den Raum herzustellen<br />
versucht, an dem man „ganz aufmacht“. Sein Haus bauen – das<br />
heißt den Ort <strong>und</strong> die Hülle erzeugen, wo man sich hingibt.<br />
Diese Auslieferung an die gebaute Umgebung ist etwas, was<br />
man üblicherweise als Eigenheim missversteht – doch erfahren<br />
wir bei Paul Valéry Gründe, dieser oberflächlichen Deutung des<br />
Wohnens zu misstrauen.<br />
Der neue platonische Dialog, verfasst in der Zeit des Bauhauses<br />
von Weimar <strong>und</strong> der frühen Entwürfe von Le Corbusier, stellt<br />
meines Wissens das erste luzide Dokument dessen dar, was man<br />
die Immersionsdämmerung des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts nennen könnte.<br />
Acht Jahre später nimmt der junge Heidegger in Sein <strong>und</strong> Zeit<br />
den Faden seiner Analyse des In-der-Welt-Seins <strong>und</strong> des<br />
Gestimmtseins auf – eine Provokation, der Heideggers Lehrer<br />
Husserl etwas später (in dem Krisis-Werk von 1936) die Analyse<br />
der „Lebenswelt“ entgegenstellen wird. 1921 bereits lässt Valéry<br />
in Eupalinos Sokrates Folgendes sagen:<br />
„Es reizt mich, über die Künste zu schwätzen. Eine Malerei, lieber<br />
Phaidros, bedeckt nur eine Oberfläche, die einer Bildtafel<br />
oder einer Mauer, aber ein Tempel, wenn man an ihn herantritt<br />
oder gar das Innere dieses Tempels, bildet für uns eine Art von<br />
vollständiger Großheit, in der wir leben. Wir sind dann, wir<br />
bewegen uns, wir leben im Werk eines Menschen. Wir sind<br />
ergriffen <strong>und</strong> gemeistert von den Verhältnissen, die er gewählt<br />
hat, wir können ihm nicht entgehen.“<br />
Der Totalitarismus der <strong>Architektur</strong> ist ein<br />
Totalitarismus der Liebe, der Raumliebe, der<br />
Hingerissenheit durch das, was uns nicht nur<br />
gegenüber ist, sondern uns wie eine Hülle<br />
umgibt.<br />
Hier ist das totalitäre Motiv klar ausgesprochen. Im übrigen<br />
hören Sie in der Rede des Sokrates – etwas anachronistisch –<br />
eine Anspielung auf die Ansprache des Paulus auf dem Areopag<br />
von Athen, (nachzulesen im 17. Kapitel der Apostelgeschichte<br />
des Neuen Testaments), wo Paulus in einem tollkühnen theologischen<br />
Piratenstück den unbekannten Gott der Griechen, (für den<br />
zu Athen ein Altar errichtet war – man weiß ja nie), für seinen<br />
Herrn Christus reklamiert. Paulus, der größte aller Piraten, suchte<br />
die schwache Stelle im Pantheon der Griechen <strong>und</strong> wurde fündig.<br />
Woraufhin er den Athenern zu verstehen gibt: Auch ihr, Bürger<br />
dieser stolzen Stadt, habt, ohne ganz zu wissen, was Ihr tut,<br />
bereits den wahren Gott verehrt, nämlich den unbekannten, dessen<br />
Pseudonym heute zu lüften ich die Ehre habe. Und hier folgt die<br />
großartige Formel von dem Gott, in dem wir leben, weben <strong>und</strong><br />
sind – jetzt zitiere ich die Lutherübersetzung, die den älteren<br />
Sprechern des Deutschen, soweit sie im protestantischen Kulturäther<br />
aufgewachsen sind, noch im Ohr sein dürfte. „In ihm leben<br />
wir, weben wir <strong>und</strong> sind wir“ – das ist die unüberbietbare Gr<strong>und</strong>aussage<br />
christlicher Raumphilosophie. Mit ihr ist gesagt, dass<br />
Menschen nicht einfach so in der Welt sind, wie die Kieselsteine<br />
<strong>und</strong> andere in sich verschlossene Entitäten in ihr herumliegen.<br />
Menschen sind ekstatisch in der Welt, sie sind im Modus der<br />
Weltoffenheit da, <strong>und</strong> offen sein heißt, beim Hiersein zugleich an<br />
anderer Stelle zu sein – dort <strong>und</strong> da in einem. Das geht so weit,<br />
dass man die Menschen oder ihre Seelen, der theologisch zugespitzten<br />
Aussage gemäß, geradezu in Gott sein <strong>und</strong> leben lässt,<br />
das heißt in einem Gegenraum, einem Überraum, der den profanen<br />
<strong>und</strong> physikalischen Raum durchdringt. Eben diese Aussage –<br />
oder besser eine Variante von ihr – legt Valéry nun seinem Sokrates<br />
in den M<strong>und</strong>, indem dieser davon spricht, dass wir, wenn wir uns<br />
in einem Gebäude aufhalten, im Werk eines Menschen leben,<br />
uns in ihm bewegen <strong>und</strong> in ihm sind. Valéry weiß genau, was er<br />
zitiert, <strong>und</strong> indem er Paulus indirekt das Wort gibt, macht er sich<br />
gewissermaßen die theologische, die psychosemantische <strong>und</strong><br />
immunologische Definition des Hauses zu eigen.




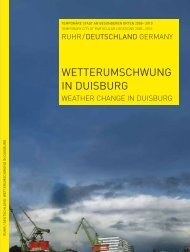
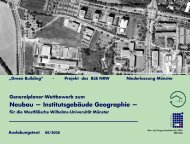





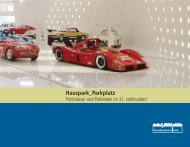




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)