Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Architektur und Politik - Landesinitiative StadtBauKultur NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Begriff „Neoliberalismus“ fast schon wieder zum Schimpfwort<br />
geworden. Allenthalben wird heute darüber disputiert, wie der<br />
Ellenbogenkapitalismus der neunziger Jahre gezähmt <strong>und</strong> vermenschlicht<br />
werden könne.<br />
So kommt es, dass sich zwölf Jahre nach dem Mauerfall Sorge<br />
ausbreitet, ob unsere Wirtschaftsordnung Zukunft hat, wenn sie<br />
so weiter macht wie in den letzten Jahren. So ist auch zu erklären,<br />
dass kritische Analysen des Kapitalismus auf dem Büchermarkt<br />
zu Bestsellern geworden sind. Dazu gehören das Manifest<br />
der Französin Viviane Forrester – „Der Terror der Ökonomie“, der<br />
Aufschrei der Gräfin Dönhoff „Zivilisiert den Kapitalismus!“ <strong>und</strong><br />
Naomi Kleins Protest-Dokument „No Logo“. Dazu gehören<br />
jedoch auch die Mahnungen von Erz-Kapitalisten wie die des<br />
Großspekulanten (<strong>und</strong> Großphilanthropen) Georg Soros oder<br />
jene des französischen Großversicherers Claude Bébéar. In seinem<br />
Buch „Die Krise des globalen Kapitalismus“ nannte Soros es<br />
wahrscheinlich, „dass die gegenwärtige Version des Kapitalismus<br />
ein schlimmes Ende findet“. Soros erinnerte daran, dass Adam<br />
Smith mit seiner Wirtschaftstheorie eine Moralphilosophie verband,<br />
die keineswegs auf Sozialdarwinismus <strong>und</strong> „Raubkapitalismus“<br />
hinausläuft. Kurz <strong>und</strong> bündig befand er: „Das Überleben der<br />
Stärksten kann nicht zum Leitprinzip einer Gesellschaft werden.“<br />
Ins gleiche Horn stieß jüngst der „Pate“ der französischen<br />
Geschäftswelt, der Groß-Versicherer Bébéar. In seinem Buch „Ils<br />
vont tuer le capitalisme“ übt er scharfe Kritik an dem System,<br />
das ihn reich gemacht hat. Sein Ruf nach Reform zielt in erster<br />
Linie auf einen schleunigen Abschied vom Quartalsdenken, das<br />
zur Fälschung der Bücher <strong>und</strong> zu Unehrlichkeit verführt; in zwei-<br />
ter Linie, dass alle Anspruchsgruppen sich wieder auf ihre<br />
Pflichten besinnen <strong>und</strong> nicht nur ihre Rechte wahrnehmen.<br />
Die Ursachen der Krise<br />
Wie kam es zu der ökonomischen <strong>und</strong> moralischen Krise des<br />
Kapitalismus an der Wende vom 20. zum 21. Jahrh<strong>und</strong>ert?<br />
Vier Ursachen lassen sich dafür dingfest machen: die Globalisierung,<br />
die permanente technologische Innovation, die Überheblichkeit<br />
<strong>und</strong> Skrupellosigkeit vieler Angehöriger der Managerklasse,<br />
schließlich die Hilflosigkeit <strong>und</strong> Ratlosigkeit der Regierungen<br />
angesichts der hartnäckigen strukturellen Arbeitslosigkeit.<br />
Die Globalisierung setzte, Zufall oder nicht, zugleich mit dem<br />
Ende des Kalten Krieges ein <strong>und</strong> griff danach ungebremst um<br />
sich. Nun ist Globalisierung an sich nichts Neues. Sie ist im<br />
Gange, seit die Menschen der Urzeit aus ihren Höhlen in die<br />
Weite der Welt aufbrachen. Sie begann als Produkt-Transfer:<br />
Marco Polo brachte die Nudeln <strong>und</strong> den Rhabarber aus China<br />
nach Europa; Seide <strong>und</strong> Spezereien kamen aus Asien in unsere<br />
Alte Welt; Shakespeares „Perfumes of Arabia“ hüllten im<br />
Abendland die Damen der feinen Gesellschaft ein.<br />
Was wir heute Globalisierung nennen, ist freilich etwas ganz<br />
anderes. Nicht länger geht es bloß um Warenaustausch. Es geht<br />
um die Entnationalisierung der Warenproduktion – „Made in<br />
Germany“ ist eine bedeutungslose Floskel geworden, seitdem<br />
ein deutsches Automobil Teile aus 40 Herren Länder enthält. Es<br />
geht um die Entnationalisierung der Arbeit – produziert wird, wo<br />
Die zweite Ursache der Krise des Kapitalismus liegt in der unaufhörlichen,<br />
ständig sich beschleunigenden technologischen Innovation. Sie wird uns<br />
bald an einen Punkt bringen, wo überhaupt nur noch ein knappes Sechstel<br />
der arbeitenden Menschen mit der Produktion von Gütern beschäftigt ist.<br />
es am billigsten ist; die Arbeitsplätze werden nicht weniger, aber<br />
sie wandern aus. Und es geht um die Entnationalisierung der<br />
letzten Entscheidungsgewalt – die nationalen Regierungen<br />
haben nicht mehr viel mitzureden. Die Entscheidungsträger der<br />
Wirtschaft verselbständigen sich in einem kontrollfreien Raum, in<br />
dem noch keine internationale Obrigkeit die Steuerungs- <strong>und</strong><br />
Aufsichtsfunktionen der entmachteten, umgangenen nationalen<br />
Obrigkeit übernommen hat.<br />
Die zweite Ursache der Krise des Kapitalismus liegt in der unaufhörlichen,<br />
ständig sich beschleunigenden technologischen Innovation.<br />
Sie wird uns bald an einen Punkt bringen, wo überhaupt<br />
nur noch ein knappes Sechstel der arbeitenden Menschen mit<br />
der Produktion von Gütern beschäftigt ist. Dies wirft die bedrückende<br />
Frage auf, ob die Industrie den Weg der Landwirtschaft<br />
geht. Wird der technische Fortschritt im Zeitalter des Spätkapitalismus<br />
die Industrie-Arbeiterschaft genau so verringern wie einst<br />
die Zahl der Bauern <strong>und</strong> Landarbeiter? Wird der Mensch als<br />
Arbeitskraft genau so überflüssig wie nach der Einführung des<br />
Traktors das Pferd? Und wird die neue Wissensindustrie all jenen<br />
Arbeit <strong>und</strong> Brot verschaffen können, die in der Güterproduktion<br />
nicht mehr gebraucht werden?<br />
Auf jeden Fall ermöglicht die neue Technik im 21. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
einen gewaltigen Produktionsanstieg von Gütern <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
mit einem Bruchteil der Arbeitskräfte, die wir heute<br />
beschäftigen. Mit dem downsizing der Kosten geht das downsizing<br />
der menschlichen Arbeitskraft einher. Auf die dadurch aufgeworfenen<br />
sozialen Fragen haben wir bis heute keine Antwort gef<strong>und</strong>en.


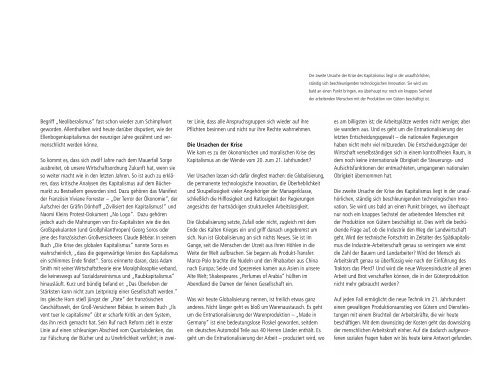

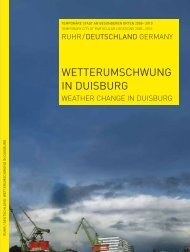
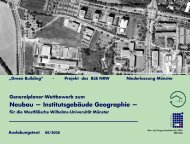





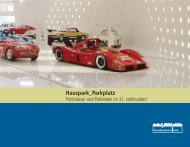




![Werkstattbericht [3] - Landesinitiative StadtBauKultur NRW](https://img.yumpu.com/6137931/1/184x260/werkstattbericht-3-landesinitiative-stadtbaukultur-nrw.jpg?quality=85)