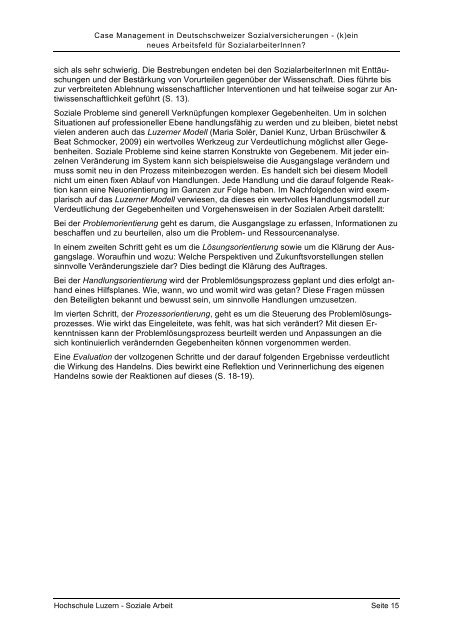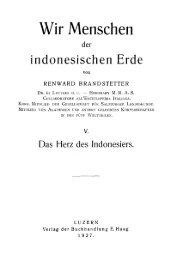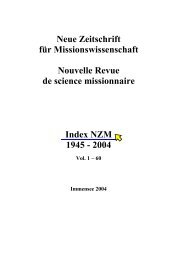Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Case Management in Deutschschweizer Sozialversicherungen - (k)ein<br />
neues Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen?<br />
sich als sehr schwierig. Die Bestrebungen endeten bei den SozialarbeiterInnen mit Enttäuschungen<br />
und der Bestärkung von Vorurteilen gegenüber der Wissenschaft. Dies führte bis<br />
<strong>zur</strong> verbreiteten Ablehnung wissenschaftlicher Interventionen und hat teilweise sogar <strong>zur</strong> Antiwissenschaftlichkeit<br />
geführt (S. 13).<br />
Soziale Probleme sind generell Verknüpfungen komplexer Gegebenheiten. Um in solchen<br />
Situationen auf professioneller Ebene handlungsfähig zu werden und zu bleiben, bietet nebst<br />
vielen anderen auch das Luzerner Modell (Maria Solèr, Daniel Kunz, Urban Brüschwiler &<br />
Beat Schmocker, 2009) ein wertvolles Werkzeug <strong>zur</strong> Verdeutlichung möglichst aller Gegebenheiten.<br />
Soziale Probleme sind keine starren Konstrukte von Gegebenem. Mit jeder einzelnen<br />
Veränderung im System kann sich beispielsweise die Ausgangslage verändern und<br />
muss somit neu in den Prozess miteinbezogen werden. Es handelt sich bei diesem Modell<br />
nicht um einen fixen Ablauf von Handlungen. Jede Handlung und die darauf folgende Reaktion<br />
kann eine Neuorientierung im Ganzen <strong>zur</strong> Folge haben. Im Nachfolgenden wird exemplarisch<br />
auf das Luzerner Modell verwiesen, da dieses ein wertvolles Handlungsmodell <strong>zur</strong><br />
Verdeutlichung der Gegebenheiten und Vorgehensweisen in der Sozialen Arbeit darstellt:<br />
Bei der Problemorientierung geht es darum, die Ausgangslage zu erfassen, Informationen zu<br />
beschaffen und zu beurteilen, also um die Problem- und Ressourcenanalyse.<br />
In einem zweiten Schritt geht es um die Lösungsorientierung sowie um die Klärung der Ausgangslage.<br />
Woraufhin und wozu: Welche Perspektiven und Zukunftsvorstellungen stellen<br />
sinnvolle Veränderungsziele dar? Dies bedingt die Klärung des Auftrages.<br />
Bei der Handlungsorientierung wird der Problemlösungsprozess geplant und dies erfolgt anhand<br />
eines Hilfsplanes. Wie, wann, wo und womit wird was getan? Diese Fragen müssen<br />
den Beteiligten bekannt und bewusst sein, um sinnvolle Handlungen umzusetzen.<br />
Im vierten Schritt, der Prozessorientierung, geht es um die Steuerung des Problemlösungsprozesses.<br />
Wie wirkt das Eingeleitete, was fehlt, was hat sich verändert? Mit diesen Erkenntnissen<br />
kann der Problemlösungsprozess beurteilt werden und Anpassungen an die<br />
sich kontinuierlich verändernden Gegebenheiten können vorgenommen werden.<br />
Eine Evaluation der vollzogenen Schritte und der darauf folgenden Ergebnisse verdeutlicht<br />
die Wirkung des Handelns. Dies bewirkt eine Reflektion und Verinnerlichung des eigenen<br />
Handelns sowie der Reaktionen auf dieses (S. 18-19).<br />
Hochschule Luzern - Soziale Arbeit Seite 15