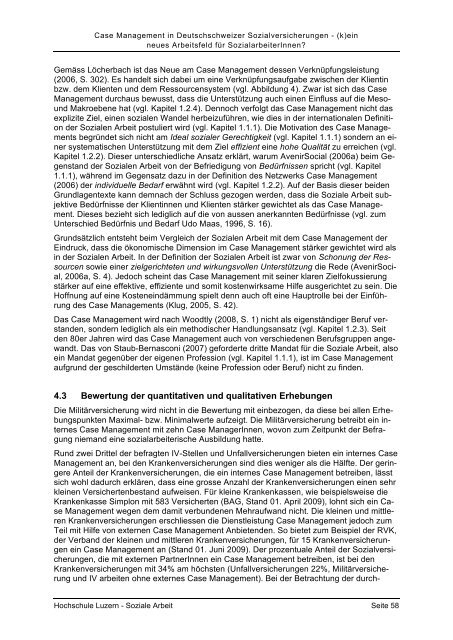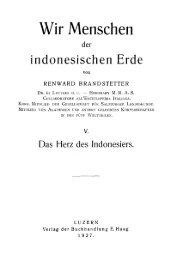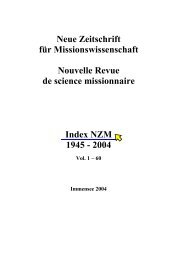Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Case Management in Deutschschweizer Sozialversicherungen - (k)ein<br />
neues Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen?<br />
Gemäss Löcherbach ist das Neue am Case Management dessen Verknüpfungsleistung<br />
(2006, S. 302). Es handelt sich dabei um eine Verknüpfungsaufgabe zwischen der Klientin<br />
bzw. dem Klienten und dem Ressourcensystem (vgl. Abbildung 4). Zwar ist sich das Case<br />
Management durchaus bewusst, dass die Unterstützung auch einen Einfluss auf die Meso-<br />
und Makroebene hat (vgl. Kapitel 1.2.4). Dennoch verfolgt das Case Management nicht das<br />
explizite Ziel, einen sozialen Wandel herbeizuführen, wie dies in der internationalen Definition<br />
der Sozialen Arbeit postuliert wird (vgl. Kapitel 1.1.1). Die Motivation des Case Managements<br />
begründet sich nicht am Ideal sozialer Gerechtigkeit (vgl. Kapitel 1.1.1) sondern an einer<br />
systematischen Unterstützung mit dem Ziel effizient eine hohe Qualität zu erreichen (vgl.<br />
Kapitel 1.2.2). Dieser unterschiedliche Ansatz erklärt, warum AvenirSocial (2006a) beim Gegenstand<br />
der Sozialen Arbeit von der Befriedigung von Bedürfnissen spricht (vgl. Kapitel<br />
1.1.1), während im Gegensatz dazu in der Definition des Netzwerks Case Management<br />
(2006) der individuelle Bedarf erwähnt wird (vgl. Kapitel 1.2.2). Auf der Basis dieser beiden<br />
Grundlagentexte kann demnach der Schluss gezogen werden, dass die Soziale Arbeit subjektive<br />
Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten stärker gewichtet als das Case Management.<br />
Dieses bezieht sich lediglich auf die von aussen anerkannten Bedürfnisse (vgl. zum<br />
Unterschied Bedürfnis und Bedarf Udo Maas, 1996, S. 16).<br />
Grundsätzlich entsteht beim Vergleich der Sozialen Arbeit mit dem Case Management der<br />
Eindruck, dass die ökonomische Dimension im Case Management stärker gewichtet wird als<br />
in der Sozialen Arbeit. In der Definition der Sozialen Arbeit ist zwar von Schonung der Ressourcen<br />
sowie einer zielgerichteten und wirkungsvollen Unterstützung die Rede (AvenirSocial,<br />
2006a, S. 4). Jedoch scheint das Case Management mit seiner klaren Zielfokussierung<br />
stärker auf eine effektive, effiziente und somit kostenwirksame Hilfe ausgerichtet zu sein. Die<br />
Hoffnung auf eine Kosteneindämmung spielt denn auch oft eine Hauptrolle bei der Einführung<br />
des Case Managements (Klug, 2005, S. 42).<br />
Das Case Management wird nach Woodtly (2008, S. 1) nicht als eigenständiger Beruf verstanden,<br />
sondern lediglich als ein methodischer Handlungsansatz (vgl. Kapitel 1.2.3). Seit<br />
den 80er Jahren wird das Case Management auch von verschiedenen Berufsgruppen angewandt.<br />
Das von Staub-Bernasconi (2007) geforderte dritte Mandat für die Soziale Arbeit, also<br />
ein Mandat gegenüber der eigenen Profession (vgl. Kapitel 1.1.1), ist im Case Management<br />
aufgrund der geschilderten Umstände (keine Profession oder Beruf) nicht zu finden.<br />
4.3 Bewertung der quantitativen und qualitativen Erhebungen<br />
Die Militärversicherung wird nicht in die Bewertung mit einbezogen, da diese bei allen Erhebungspunkten<br />
Maximal- bzw. Minimalwerte aufzeigt. Die Militärversicherung betreibt ein internes<br />
Case Management mit zehn Case ManagerInnen, wovon zum Zeitpunkt der Befragung<br />
niemand eine sozialarbeiterische Ausbildung hatte.<br />
Rund zwei Drittel der befragten IV-Stellen und Unfallversicherungen bieten ein internes Case<br />
Management an, bei den Krankenversicherungen sind dies weniger als die Hälfte. Der geringere<br />
Anteil der Krankenversicherungen, die ein internes Case Management betreiben, lässt<br />
sich wohl dadurch erklären, dass eine grosse Anzahl der Krankenversicherungen einen sehr<br />
kleinen Versichertenbestand aufweisen. Für kleine Krankenkassen, wie beispielsweise die<br />
Krankenkasse Simplon mit 583 Versicherten (BAG, Stand 01. April 2009), lohnt sich ein Case<br />
Management wegen dem damit verbundenen Mehraufwand nicht. Die kleinen und mittleren<br />
Krankenversicherungen erschliessen die Dienstleistung Case Management jedoch zum<br />
Teil mit Hilfe von externen Case Management Anbietenden. So bietet zum Beispiel der RVK,<br />
der Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherungen, für 15 Krankenversicherungen<br />
ein Case Management an (Stand 01. Juni 2009). Der prozentuale Anteil der Sozialversicherungen,<br />
die mit externen PartnerInnen ein Case Management betreiben, ist bei den<br />
Krankenversicherungen mit 34% am höchsten (Unfallversicherungen 22%, Militärversicherung<br />
und IV arbeiten ohne externes Case Management). Bei der Betrachtung der durch-<br />
Hochschule Luzern - Soziale Arbeit Seite 58