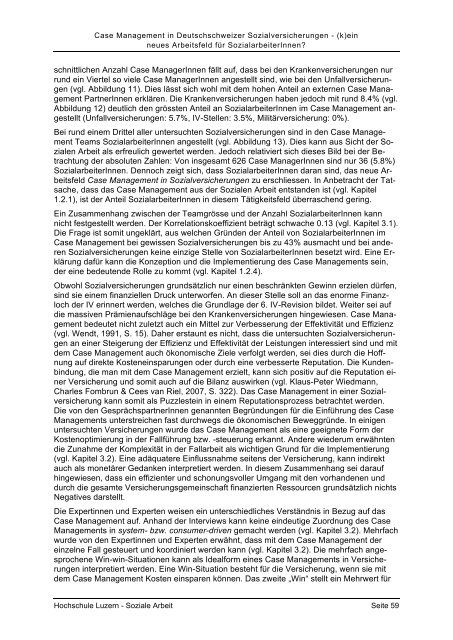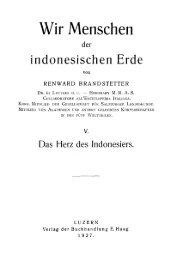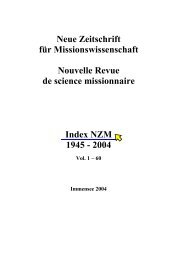Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Case Management in Deutschschweizer Sozialversicherungen - (k)ein<br />
neues Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen?<br />
schnittlichen Anzahl Case ManagerInnen fällt auf, dass bei den Krankenversicherungen nur<br />
rund ein Viertel so viele Case ManagerInnen angestellt sind, wie bei den Unfallversicherungen<br />
(vgl. Abbildung 11). Dies lässt sich wohl mit dem hohen Anteil an externen Case Management<br />
PartnerInnen erklären. Die Krankenversicherungen haben jedoch mit rund 8.4% (vgl.<br />
Abbildung 12) deutlich den grössten Anteil an SozialarbeiterInnen im Case Management angestellt<br />
(Unfallversicherungen: 5.7%, IV-Stellen: 3.5%, Militärversicherung: 0%).<br />
Bei rund einem Drittel aller untersuchten Sozialversicherungen sind in den Case Management<br />
Teams SozialarbeiterInnen angestellt (vgl. Abbildung 13). Dies kann aus Sicht der Sozialen<br />
Arbeit als erfreulich gewertet werden. Jedoch relativiert sich dieses Bild bei der Betrachtung<br />
der absoluten Zahlen: Von insgesamt 626 Case ManagerInnen sind nur 36 (5.8%)<br />
SozialarbeiterInnen. Dennoch zeigt sich, dass SozialarbeiterInnen daran sind, das neue Arbeitsfeld<br />
Case Management in Sozialversicherungen zu erschliessen. In Anbetracht der Tatsache,<br />
dass das Case Management aus der Sozialen Arbeit entstanden ist (vgl. Kapitel<br />
1.2.1), ist der Anteil SozialarbeiterInnen in diesem Tätigkeitsfeld überraschend gering.<br />
Ein Zusammenhang zwischen der Teamgrösse und der Anzahl SozialarbeiterInnen kann<br />
nicht festgestellt werden. Der Korrelationskoeffizient beträgt schwache 0.13 (vgl. Kapitel 3.1).<br />
Die Frage ist somit ungeklärt, aus welchen Gründen der Anteil von SozialarbeiterInnen im<br />
Case Management bei gewissen Sozialversicherungen bis zu 43% ausmacht und bei anderen<br />
Sozialversicherungen keine einzige Stelle von SozialarbeiterInnen besetzt wird. Eine Erklärung<br />
dafür kann die Konzeption und die Implementierung des Case Managements sein,<br />
der eine bedeutende Rolle zu kommt (vgl. Kapitel 1.2.4).<br />
Obwohl Sozialversicherungen grundsätzlich nur einen beschränkten Gewinn erzielen dürfen,<br />
sind sie einem finanziellen Druck unterworfen. An dieser Stelle soll an das enorme Finanzloch<br />
der IV erinnert werden, welches die Grundlage der 6. IV-Revision bildet. Weiter sei auf<br />
die massiven Prämienaufschläge bei den Krankenversicherungen hingewiesen. Case Management<br />
bedeutet nicht zuletzt auch ein Mittel <strong>zur</strong> Verbesserung der Effektivität und Effizienz<br />
(vgl. Wendt, 1991, S. 15). Daher erstaunt es nicht, dass die untersuchten Sozialversicherungen<br />
an einer Steigerung der Effizienz und Effektivität der Leistungen interessiert sind und mit<br />
dem Case Management auch ökonomische Ziele verfolgt werden, sei dies durch die Hoffnung<br />
auf direkte Kosteneinsparungen oder durch eine verbesserte Reputation. Die Kundenbindung,<br />
die man mit dem Case Management erzielt, kann sich positiv auf die Reputation einer<br />
Versicherung und somit auch auf die Bilanz auswirken (vgl. Klaus-Peter Wiedmann,<br />
Charles Fombrun & Cees van Riel, 2007, S. 322). Das Case Management in einer Sozialversicherung<br />
kann somit als Puzzlestein in einem Reputationsprozess betrachtet werden.<br />
Die von den GesprächspartnerInnen genannten Begründungen für die Einführung des Case<br />
Managements unterstreichen fast durchwegs die ökonomischen Beweggründe. In einigen<br />
untersuchten Versicherungen wurde das Case Management als eine geeignete Form der<br />
Kostenoptimierung in der Fallführung bzw. -steuerung erkannt. Andere wiederum erwähnten<br />
die Zunahme der Komplexität in der Fallarbeit als wichtigen Grund für die Implementierung<br />
(vgl. Kapitel 3.2). Eine adäquatere Einflussnahme seitens der Versicherung, kann indirekt<br />
auch als monetärer Gedanken interpretiert werden. In diesem Zusammenhang sei darauf<br />
hingewiesen, dass ein effizienter und schonungsvoller Umgang mit den vorhandenen und<br />
durch die gesamte Versicherungsgemeinschaft finanzierten Ressourcen grundsätzlich nichts<br />
Negatives darstellt.<br />
Die Expertinnen und Experten weisen ein unterschiedliches Verständnis in Bezug auf das<br />
Case Management auf. Anhand der Interviews kann keine eindeutige Zuordnung des Case<br />
Managements in system- bzw. consumer-driven gemacht werden (vgl. Kapitel 3.2). Mehrfach<br />
wurde von den Expertinnen und Experten erwähnt, dass mit dem Case Management der<br />
einzelne Fall gesteuert und koordiniert werden kann (vgl. Kapitel 3.2). Die mehrfach angesprochene<br />
Win-win-Situationen kann als Idealform eines Case Managements in Versicherungen<br />
interpretiert werden. Eine Win-Situation besteht für die Versicherung, wenn sie mit<br />
dem Case Management Kosten einsparen können. Das zweite „Win“ stellt ein Mehrwert für<br />
Hochschule Luzern - Soziale Arbeit Seite 59