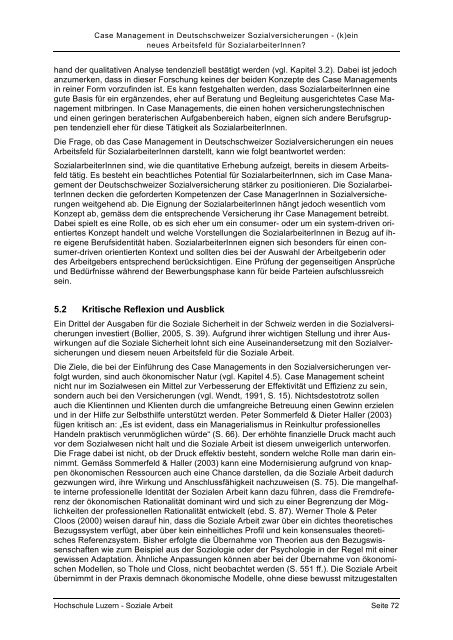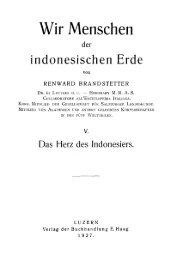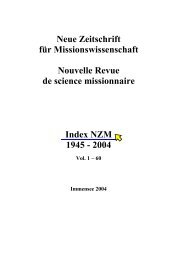Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Case Management in Deutschschweizer Sozialversicherungen - (k)ein<br />
neues Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen?<br />
hand der qualitativen Analyse tendenziell bestätigt werden (vgl. Kapitel 3.2). Dabei ist jedoch<br />
anzumerken, dass in dieser Forschung keines der beiden Konzepte des Case Managements<br />
in reiner Form vorzufinden ist. Es kann festgehalten werden, dass SozialarbeiterInnen eine<br />
gute Basis für ein ergänzendes, eher auf Beratung und Begleitung ausgerichtetes Case Management<br />
mitbringen. In Case Managements, die einen hohen versicherungstechnischen<br />
und einen geringen beraterischen Aufgabenbereich haben, eignen sich andere Berufsgruppen<br />
tendenziell eher für diese Tätigkeit als SozialarbeiterInnen.<br />
Die Frage, ob das Case Management in Deutschschweizer Sozialversicherungen ein neues<br />
Arbeitsfeld für SozialarbeiterInnen darstellt, kann wie folgt beantwortet werden:<br />
SozialarbeiterInnen sind, wie die quantitative Erhebung aufzeigt, bereits in diesem Arbeitsfeld<br />
tätig. Es besteht ein beachtliches Potential für SozialarbeiterInnen, sich im Case Management<br />
der Deutschschweizer Sozialversicherung stärker zu positionieren. Die SozialarbeiterInnen<br />
decken die geforderten Kompetenzen der Case ManagerInnen in Sozialversicherungen<br />
weitgehend ab. Die Eignung der SozialarbeiterInnen hängt jedoch wesentlich vom<br />
Konzept ab, gemäss dem die entsprechende Versicherung ihr Case Management betreibt.<br />
Dabei spielt es eine Rolle, ob es sich eher um ein consumer- oder um ein system-driven orientiertes<br />
Konzept handelt und welche Vorstellungen die SozialarbeiterInnen in Bezug auf ihre<br />
eigene Berufsidentität haben. SozialarbeiterInnen eignen sich besonders für einen consumer-driven<br />
orientierten Kontext und sollten dies bei der Auswahl der Arbeitgeberin oder<br />
des Arbeitgebers entsprechend berücksichtigen. Eine Prüfung der gegenseitigen Ansprüche<br />
und Bedürfnisse während der Bewerbungsphase kann für beide Parteien aufschlussreich<br />
sein.<br />
5.2 Kritische Reflexion und Ausblick<br />
Ein Drittel der Ausgaben für die Soziale Sicherheit in der Schweiz werden in die Sozialversicherungen<br />
investiert (Bollier, 2005, S. 39). Aufgrund ihrer wichtigen Stellung und ihrer Auswirkungen<br />
auf die Soziale Sicherheit lohnt sich eine Auseinandersetzung mit den Sozialversicherungen<br />
und diesem neuen Arbeitsfeld für die Soziale Arbeit.<br />
Die Ziele, die bei der Einführung des Case Managements in den Sozialversicherungen verfolgt<br />
wurden, sind auch ökonomischer Natur (vgl. Kapitel 4.5). Case Management scheint<br />
nicht nur im Sozialwesen ein Mittel <strong>zur</strong> Verbesserung der Effektivität und Effizienz zu sein,<br />
sondern auch bei den Versicherungen (vgl. Wendt, 1991, S. 15). Nichtsdestotrotz sollen<br />
auch die Klientinnen und Klienten durch die umfangreiche Betreuung einen Gewinn erzielen<br />
und in der Hilfe <strong>zur</strong> Selbsthilfe unterstützt werden. Peter Sommerfeld & Dieter Haller (2003)<br />
fügen kritisch an: „Es ist evident, dass ein Managerialismus in Reinkultur professionelles<br />
Handeln praktisch verunmöglichen würde“ (S. 66). Der erhöhte finanzielle Druck macht auch<br />
vor dem Sozialwesen nicht halt und die Soziale Arbeit ist diesem unweigerlich unterworfen.<br />
Die Frage dabei ist nicht, ob der Druck effektiv besteht, sondern welche Rolle man darin einnimmt.<br />
Gemäss Sommerfeld & Haller (2003) kann eine Modernisierung aufgrund von knappen<br />
ökonomischen Ressourcen auch eine Chance darstellen, da die Soziale Arbeit dadurch<br />
gezwungen wird, ihre Wirkung und Anschlussfähigkeit nachzuweisen (S. 75). Die mangelhafte<br />
interne professionelle Identität der Sozialen Arbeit kann dazu führen, dass die Fremdreferenz<br />
der ökonomischen Rationalität dominant wird und sich zu einer Begrenzung der Möglichkeiten<br />
der professionellen Rationalität entwickelt (ebd. S. 87). Werner Thole & Peter<br />
Cloos (2000) weisen darauf hin, dass die Soziale Arbeit zwar über ein dichtes theoretisches<br />
Bezugssystem verfügt, aber über kein einheitliches Profil und kein konsensuales theoretisches<br />
Referenzsystem. Bisher erfolgte die Übernahme von Theorien aus den Bezugswissenschaften<br />
wie zum Beispiel aus der Soziologie oder der Psychologie in der Regel mit einer<br />
gewissen Adaptation. Ähnliche Anpassungen können aber bei der Übernahme von ökonomischen<br />
Modellen, so Thole und Closs, nicht beobachtet werden (S. 551 ff.). Die Soziale Arbeit<br />
übernimmt in der Praxis demnach ökonomische Modelle, ohne diese bewusst mitzugestalten<br />
Hochschule Luzern - Soziale Arbeit Seite 72