Jesus versus Jaldabaoth – Gnostische Elemente in ... - Radikalkritik
Jesus versus Jaldabaoth – Gnostische Elemente in ... - Radikalkritik
Jesus versus Jaldabaoth – Gnostische Elemente in ... - Radikalkritik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
66<br />
gängigen Anschauung folgten. Wir haben es offenbar mit e<strong>in</strong>er ganz unabhängigen<br />
Überlieferung zu tun, die ke<strong>in</strong>erlei Verb<strong>in</strong>dung zur neutestamentlichen<br />
Verrats- bzw. Passionsgeschichte erkennen lässt und die auch<br />
nicht als „Midrasch“ von 2:6-8 gelten kann.<br />
Fast ist man an dieser Stelle versucht, <strong>in</strong> dem Text e<strong>in</strong> Indiz für die alte<br />
radikalkritische These zu sehen, dass die Passionsgeschichte der Evangelien<br />
<strong>in</strong> wesentlichen Teilen nichts anderes ist als e<strong>in</strong> historisch e<strong>in</strong>gekleideter<br />
gnostischer Erlösermythos. Die L<strong>in</strong>ien von der mythischen zur<br />
historisierten Version lassen sich leicht ausziehen <strong>–</strong> das Umgekehrte ist<br />
wesentlich schwieriger: So ist es gut möglich, dass aus der noch namenlosen,<br />
nebulös-mythischen Gestalt des „Auslieferers“ die Figur des Verräters<br />
Judas wurde. Aus den mythischen Archonten könnten sich historische<br />
Personen, die „Machthaber“ der Passionsgeschichte entwickelt haben:<br />
der römische Statthalter und die Vertreter des jüdischen Establishments.<br />
Das könnte im Übrigen auch die von Carr beobachtete auffallende<br />
Häufigkeit des Begriffs archontes <strong>in</strong>nerhalb der Passionsgeschichte erklären.<br />
Dass die Priester <strong>Jesus</strong> ohne Hilfe des Judas nicht erkannten,<br />
könnte als e<strong>in</strong> Reflex des Mythos vom verborgenen Erlöser gesehen werden.<br />
Dieser Zug der Erzählung, der <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es historischen Rahmens<br />
natürlich ke<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n mehr macht, wäre e<strong>in</strong>fach aus dem Mythos mitgeschleppt<br />
worden. Die neun Bronzemünzen wären von Matthäus durch die<br />
30 Silberl<strong>in</strong>ge ersetzt worden, die ihrerseits deutlich auf den Propheten<br />
Sacharja anspielen (11:12.13); der atl. Bezug diente wie so oft dazu, die<br />
neutestamentlichen Heilsgeschichte an das Alte Testament anzub<strong>in</strong>den<br />
und gegen gnostische „Missdeutungen“ zu sichern.<br />
Doch angesichts des fragmentarischen Charakters des Erlösermythos,<br />
den uns die Schrift Der Gedanke unserer großen Kraft erzählt, sowie der<br />
ungeklärten Frage nach Alter und Herkunft der Schrift und den <strong>in</strong> ihr<br />
enthaltenen Traditionen, müssen solche Überlegungen spekulativ bleiben.<br />
Der Nachweis, dass die Passionsgeschichte e<strong>in</strong>e historisierte Fassung<br />
des gnostischen Erlösermythos darstellt, müsste im größeren Rahmen<br />
geschehen.<br />
Es bleibt dabei: Bei den „Herrschern dieser Weltzeit“ <strong>in</strong> 1 Kor 2:6-8<br />
handelt es sich um supratanaturale Wesen bzw. um die Archonten des<br />
gnostischen Mythos, der <strong>in</strong> den gnostischen Systemen des 2. Jahrhunderts<br />
<strong>in</strong> verschiedenen Variationen überliefert wurde. Wenn dieser Mythos<br />
bzw. wesentliche Bestandteile dieses Mythos dem Verfasser des Kor<strong>in</strong>therbriefs<br />
bekannt waren, woran angesichts des zum Vergleich herangezogenen<br />
Materials und der gänzlichen Unhaltbarkeit von Deutung B<br />
nicht zu zweifeln ist, so muss auch dieser <strong>in</strong> das 2. Jahrhundert datiert<br />
werden. Es sei den, es hätte e<strong>in</strong>e „vorchristliche Gnosis“ oder e<strong>in</strong>e Protognosis<br />
bzw. Gnosis <strong>in</strong> statu nascendi gegeben, wofür es, wie wir <strong>in</strong>zwischen<br />
wissen, ke<strong>in</strong>e Evidenz gibt. D.h. ke<strong>in</strong>e andere Evidenz <strong>–</strong> als Paulus<br />
selbst, d.h. die gnostischen <strong>Elemente</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Sprache und Theologie.<br />
Aber diese Evidenz ist, wie jeder anerkennen wird, trotz des von den Be-<br />
© Hermann Deter<strong>in</strong>g <strong>–</strong> www.radikalkritik.de 2013


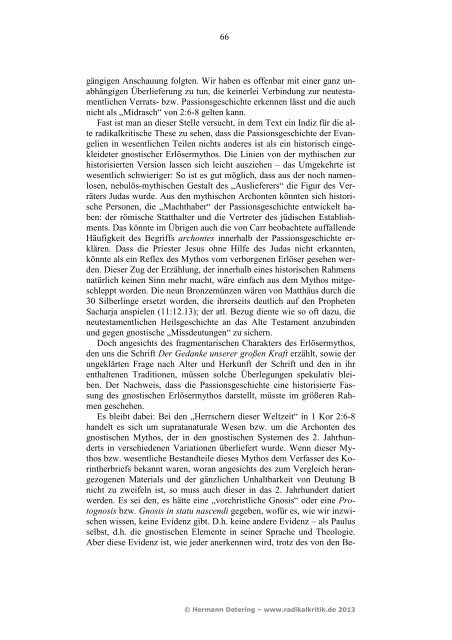




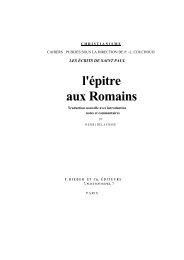
![[1] quibus tamen interfuit et ita posuit - Radikalkritik](https://img.yumpu.com/28285180/1/184x260/1-quibus-tamen-interfuit-et-ita-posuit-radikalkritik.jpg?quality=85)







