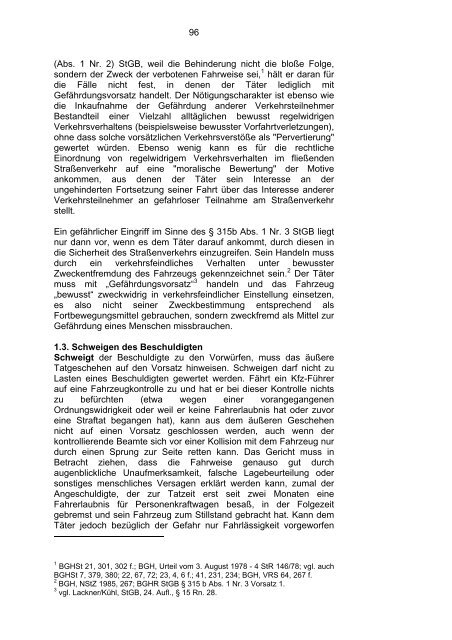Strafzumessung und Verteidigerstrategie - Ferner & Kollegen
Strafzumessung und Verteidigerstrategie - Ferner & Kollegen
Strafzumessung und Verteidigerstrategie - Ferner & Kollegen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
96<br />
(Abs. 1 Nr. 2) StGB, weil die Behinderung nicht die bloße Folge,<br />
sondern der Zweck der verbotenen Fahrweise sei, 1 hält er daran für<br />
die Fälle nicht fest, in denen der Täter lediglich mit<br />
Gefährdungsvorsatz handelt. Der Nötigungscharakter ist ebenso wie<br />
die Inkaufnahme der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer<br />
Bestandteil einer Vielzahl alltäglichen bewusst regelwidrigen<br />
Verkehrsverhaltens (beispielsweise bewusster Vorfahrtverletzungen),<br />
ohne dass solche vorsätzlichen Verkehrsverstöße als "Pervertierung"<br />
gewertet würden. Ebenso wenig kann es für die rechtliche<br />
Einordnung von regelwidrigem Verkehrsverhalten im fließenden<br />
Straßenverkehr auf eine "moralische Bewertung" der Motive<br />
ankommen, aus denen der Täter sein Interesse an der<br />
ungehinderten Fortsetzung seiner Fahrt über das Interesse anderer<br />
Verkehrsteilnehmer an gefahrloser Teilnahme am Straßenverkehr<br />
stellt.<br />
Ein gefährlicher Eingriff im Sinne des § 315b Abs. 1 Nr. 3 StGB liegt<br />
nur dann vor, wenn es dem Täter darauf ankommt, durch diesen in<br />
die Sicherheit des Straßenverkehrs einzugreifen. Sein Handeln muss<br />
durch ein verkehrsfeindliches Verhalten unter bewusster<br />
Zweckentfremdung des Fahrzeugs gekennzeichnet sein. 2 Der Täter<br />
muss mit „Gefährdungsvorsatz“ 3 handeln <strong>und</strong> das Fahrzeug<br />
„bewusst“ zweckwidrig in verkehrsfeindlicher Einstellung einsetzen,<br />
es also nicht seiner Zweckbestimmung entsprechend als<br />
Fortbewegungsmittel gebrauchen, sondern zweckfremd als Mittel zur<br />
Gefährdung eines Menschen missbrauchen.<br />
1.3. Schweigen des Beschuldigten<br />
Schweigt der Beschuldigte zu den Vorwürfen, muss das äußere<br />
Tatgeschehen auf den Vorsatz hinweisen. Schweigen darf nicht zu<br />
Lasten eines Beschuldigten gewertet werden. Fährt ein Kfz-Führer<br />
auf eine Fahrzeugkontrolle zu <strong>und</strong> hat er bei dieser Kontrolle nichts<br />
zu befürchten (etwa wegen einer vorangegangenen<br />
Ordnungswidrigkeit oder weil er keine Fahrerlaubnis hat oder zuvor<br />
eine Straftat begangen hat), kann aus dem äußeren Geschehen<br />
nicht auf einen Vorsatz geschlossen werden, auch wenn der<br />
kontrollierende Beamte sich vor einer Kollision mit dem Fahrzeug nur<br />
durch einen Sprung zur Seite retten kann. Das Gericht muss in<br />
Betracht ziehen, dass die Fahrweise genauso gut durch<br />
augenblickliche Unaufmerksamkeit, falsche Lagebeurteilung oder<br />
sonstiges menschliches Versagen erklärt werden kann, zumal der<br />
Angeschuldigte, der zur Tatzeit erst seit zwei Monaten eine<br />
Fahrerlaubnis für Personenkraftwagen besaß, in der Folgezeit<br />
gebremst <strong>und</strong> sein Fahrzeug zum Stillstand gebracht hat. Kann dem<br />
Täter jedoch bezüglich der Gefahr nur Fahrlässigkeit vorgeworfen<br />
1 BGHSt 21, 301, 302 f.; BGH, Urteil vom 3. August 1978 - 4 StR 146/78; vgl. auch<br />
BGHSt 7, 379, 380; 22, 67, 72; 23, 4, 6 f.; 41, 231, 234; BGH, VRS 64, 267 f.<br />
2 BGH, NStZ 1985, 267; BGHR StGB § 315 b Abs. 1 Nr. 3 Vorsatz 1.<br />
3 vgl. Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl., § 15 Rn. 28.