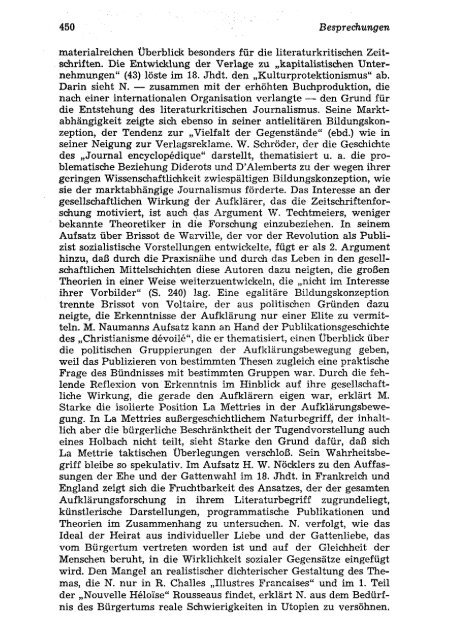Das Argument
Das Argument
Das Argument
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
450 •Besprechungen<br />
materialreichen Überblick besonders für die literaturkritischen Zeitschriften.<br />
Die Entwicklung der Verlage zu „kapitalistischen Unternehmungen"<br />
(43) löste im 18. Jhdt. den „Kulturprotektionismus" ab.<br />
Darin sieht N. — zusammen mit der erhöhten Buchproduktion, die<br />
nach einer internationalen Organisation verlangte — den Grund für<br />
die Entstehung des literaturkritischen Journalismus. Seine Marktabhängigkeit<br />
zeigte sich ebenso in seiner antielitären Bildungskonzeption,<br />
der Tendenz zur „Vielfalt der Gegenstände" (ebd.) wie in<br />
seiner Neigung zur Verlagsreklame. W. Schröder, der die Geschichte<br />
des „Journal encyclopédique" darstellt, thematisiert u. a. die problematische<br />
Beziehung Diderots und D'Alemberts zu der wegen ihrer<br />
geringen Wissenschaftlichkeit zwiespältigen Bildungskonzeption, wie<br />
sie der marktabhängige Journalismus förderte. <strong>Das</strong> Interesse an der<br />
gesellschaftlichen Wirkung der Aufklärer, das die Zeitschriftenforschung<br />
motiviert, ist auch das <strong>Argument</strong> W. Techtmeiers, weniger<br />
bekannte Theoretiker in die Forschung einzubeziehen. In seinem<br />
Aufsatz über Brissot de Warville, der vor der Revolution als Publizist<br />
sozialistische Vorstellungen entwickelte, fügt er als 2. <strong>Argument</strong><br />
hinzu, daß durch die Praxisnähe und durch das Leben in den gesellschaftlichen<br />
Mittelschichten diese Autoren dazu neigten, die großen<br />
Theorien in einer Weise weiterzuentwickeln, die „nicht im Interesse<br />
ihrer Vorbilder" (S. 240) lag. Eine egalitäre Bildungskonzeption<br />
trennte Brissot von Voltaire, der aus politischen Gründen dazu<br />
neigte, die Erkenntnisse der Aufklärung nur einer Elite zu vermitteln.<br />
M. Naumanns Aufsatz kann an Hand der Publikationsgesehichte<br />
des „Christianisme dévoilé", die er thematisiert, einen Überblick über<br />
die politischen Gruppierungen der Aufklärungsbewegung geben,<br />
weil das Publizieren von bestimmten Thesen zugleich eine praktische<br />
Frage des Bündnisses mit bestimmten Gruppen war. Durch die fehlende<br />
Reflexion von Erkenntnis im Hinblick auf ihre gesellschaftliche<br />
Wirkung, die gerade den Aufklärern eigen war, erklärt M.<br />
Starke die isolierte Position La Mettries in der Aufklärungsbewegung.<br />
In La Mettries außergeschichtlichem Naturbegriff, der inhaltlich<br />
aber die bürgerliche Beschränktheit der Tugendvorstellung auch<br />
eines Holbach nicht teilt, sieht Starke den Grund dafür, daß sich<br />
La Mettrie taktischen Überlegungen verschloß. Sein Wahrheitsbegriff<br />
bleibe so spekulativ. Im Aufsatz H. W. Nöcklers zu den Auffassungen<br />
der Ehe und der Gattenwahl im 18. Jhdt. in Frankreich und<br />
England zeigt sich die Fruchtbarkeit des Ansatzes, der der gesamten<br />
Aufklärungsforschung in ihrem Literaturbegriff zugrundeliegt,<br />
künstlerische Darstellungen, programmatische Publikationen und<br />
Theorien im Zusammenhang zu untersuchen. N. verfolgt, wie das<br />
Ideal der Heirat aus individueller Liebe und der Gattenliebe, das<br />
vom Bürgertum vertreten worden ist und auf der Gleichheit der<br />
Menschen beruht, in die Wirklichkeit sozialer Gegensätze eingefügt<br />
wird. Den Mangel an realistischer dichterischer Gestaltung des Themas,<br />
die N. nur in R. Challes „Illustres Françaises" und im 1. Teil<br />
der „Nouvelle Héloïse" Rousseaus findet, erklärt N. aus dem Bedürfnis<br />
des Bürgertums reale Schwierigkeiten in Utopien zu versöhnen.