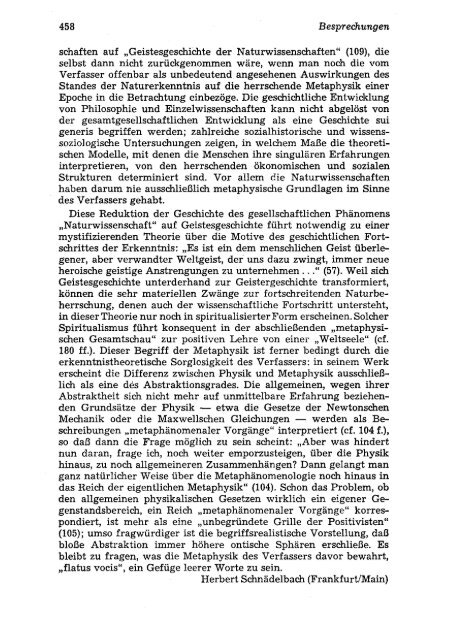Das Argument
Das Argument
Das Argument
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
458 •Besprechungen<br />
Schäften auf „Geistesgeschichte der Naturwissenschaften" (109), die<br />
selbst dann nicht zurückgenommen wäre, wenn man noch die vom<br />
Verfasser offenbar als unbedeutend angesehenen Auswirkungen des<br />
Standes der Naturerkenntnis auf die herrschende Metaphysik einer<br />
Epoche in die Betrachtung einbezöge. Die geschichtliche Entwicklung<br />
von Philosophie und Einzelwissenschaften kann nicht abgelöst von<br />
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung als eine Geschichte sui<br />
generis begriffen werden; zahlreiche sozialhistorische und wissenssoziologische<br />
Untersuchungen zeigen, in welchem Maße die theoretischen<br />
Modelle, mit denen die Menschen ihre singulären Erfahrungen<br />
interpretieren, von den herrschenden ökonomischen und sozialen<br />
Strukturen determiniert sind. Vor allem die Naturwissenschaften<br />
haben darum nie ausschließlich metaphysische Grundlagen im Sinne<br />
des Verfassers gehabt.<br />
Diese Reduktion der Geschichte des gesellschaftlichen Phänomens<br />
„Naturwissenschaft" auf Geistesgeschichte führt notwendig zu einer<br />
mystifizierenden Theorie über die Motive des geschichtlichen Fortschrittes<br />
der Erkenntnis: „Es ist ein dem menschlichen Geist überlegener,<br />
aber verwandter Weltgeist, der uns dazu zwingt, immer neue<br />
heroische geistige Anstrengungen zu unternehmen ..." (57). Weil sich<br />
Geistesgeschichte unterderhand zur Geistergeschichte transformiert,<br />
können die sehr materiellen Zwänge zur fortschreitenden Naturbeherrschung,<br />
denen auch der wissenschaftliche Fortschritt untersteht,<br />
in dieser Theorie nur noch in spiritualisierter Form erscheinen. Solcher<br />
Spiritualismus führt konsequent in der abschließenden „metaphysischen<br />
Gesamtschau" zur positiven Lehre von einer „Weltseele" (cf.<br />
180 ff.). Dieser Begriff der Metaphysik ist ferner bedingt durch die<br />
erkenntnistheoretische Sorglosigkeit des Verfassers: in seinem Werk<br />
erscheint die Differenz zwischen Physik und Metaphysik ausschließlich<br />
als eine dés Abstraktionsgrades. Die allgemeinen, wegen ihrer<br />
Abstraktheit sich nicht mehr auf unmittelbare Erfahrung beziehenden<br />
Grundsätze der Physik — etwa die Gesetze der Newtonschen<br />
Mechanik oder die Maxwellschen Gleichungen — werden als Beschreibungen<br />
„metaphänomenaler Vorgänge" interpretiert (cf. 104 f.),<br />
so daß dann die Frage möglich zu sein scheint: „Aber was hindert<br />
nun daran, frage ich, noch weiter emporzusteigen, über die Physik<br />
hinaus, zu noch allgemeineren Zusammenhängen? Dann gelangt man<br />
ganz natürlicher Weise über die Metaphänomenologie noch hinaus in<br />
das Reich der eigentlichen Metaphysik" (104). Schon das Problem, ob<br />
den allgemeinen physikalischen Gesetzen wirklich ein eigener Gegenstandsbereich,<br />
ein Reich „metaphänomenaler Vorgänge" korrespondiert,<br />
ist mehr als eine „unbegründete Grille der Positivisten"<br />
(105); umso fragwürdiger ist die begriffsrealistische Vorstellung, daß<br />
bloße Abstraktion immer höhere ontische Sphären erschließe. Es<br />
bleibt zu fragen, was die Metaphysik des Verfassers davor bewahrt,<br />
„flatus vocis", ein Gefüge leerer Worte zu sein.<br />
Herbert Schnädelbach (Frankfurt/Main)