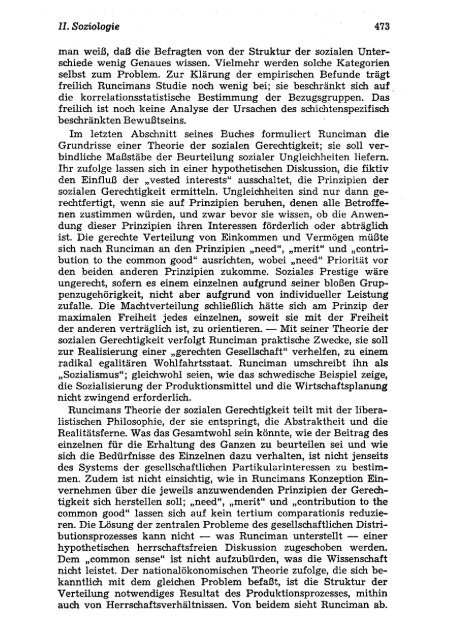Das Argument
Das Argument
Das Argument
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
II. Soziologie 473<br />
man weiß, daß die Befragten von der Struktur der sozialen Unterschiede<br />
wenig Genaues wissen. Vielmehr werden solche Kategorien<br />
selbst zum Problem. Zur Klärung der empirischen Befunde trägt<br />
freilich Runcimans Studie noch wenig bei; sie beschränkt sich auf<br />
die korrelationsstatistische Bestimmung der Bezugsgruppen. <strong>Das</strong><br />
freilich ist noch keine Analyse der Ursachen des schichtenspezifisch<br />
beschränkten Bewußtseins.<br />
Im letzten Abschnitt seines Buches formuliert Runciman die<br />
Grundrisse einer Theorie der sozialen Gerechtigkeit; sie soll verbindliche<br />
Maßstäbe der Beurteilung sozialer Ungleichheiten liefern.<br />
Ihr zufolge lassen sich in einer hypothetischen Diskussion, die fiktiv<br />
den Einfluß der „vested interests" ausschaltet, die Prinzipien der<br />
sozialen Gerechtigkeit ermitteln. Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt,<br />
wenn sie auf Prinzipien beruhen, denen alle Betroffenen<br />
zustimmen würden, und zwar bevor sie wissen, ob die Anwendung<br />
dieser Prinzipien ihren Interessen förderlich oder abträglich<br />
ist. Die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen müßte<br />
sich nach Runciman an den Prinzipien „need", „merit" und „contribution<br />
to the common good" ausrichten, wobei „need" Priorität vor<br />
den beiden anderen Prinzipien zukomme. Soziales Prestige wäre<br />
ungerecht, sofern es einem einzelnen aufgrund seiner bloßen Gruppenzugehörigkeit,<br />
nicht aber aufgrund von individueller Leistung<br />
zufalle. Die Machtverteilung schließlich hätte sich am Prinzip der<br />
maximalen Freiheit jedes einzelnen, soweit sie mit der Freiheit<br />
der anderen verträglich ist, zu orientieren. — Mit seiner Theorie der<br />
sozialen Gerechtigkeit verfolgt Runciman praktische Zwecke, sie soll<br />
zur Realisierung einer „gerechten Gesellschaft" verhelfen, zu einem<br />
radikal egalitären Wohlfahrtsstaat. Runciman umschreibt ihn als<br />
„Sozialismus"; gleichwohl seien, wie das schwedische Beispiel zeige,<br />
die Sozialisierung der Produktionsmittel und die Wirtschaftsplanung<br />
nicht zwingend erforderlich.<br />
Runcimans Theorie der sozialen Gerechtigkeit teilt mit der liberalistischen<br />
Philosophie, der sie entspringt, die Abstraktheit und die<br />
Realitätsferne. Was das Gesamtwohl sein könnte, wie der Beitrag des<br />
einzelnen für die Erhaltung des Ganzen zu beurteilen sei und wie<br />
sich die Bedürfnisse des Einzelnen dazu verhalten, ist nicht jenseits<br />
des Systems der gesellschaftlichen Partikularinteressen zu bestimmen.<br />
Zudem ist nicht einsichtig, wie in Runcimans Konzeption Einvernehmen<br />
über die jeweils anzuwendenden Prinzipien der Gerechtigkeit<br />
sich herstellen soll; „need", „merit" und „contribution to the<br />
common good" lassen sich auf kein tertium comparationis reduzieren.<br />
Die Lösung der zentralen Probleme des gesellschaftlichen Distributionsprozesses<br />
kann nicht — was Runciman unterstellt — einer<br />
hypothetischen herrschaftsfreien Diskussion zugeschoben werden.<br />
Dem „common sense" ist nicht aufzubürden, was die Wissenschaft<br />
nicht leistet. Der nationalökonomischen Theorie zufolge, die sich bekanntlich<br />
mit dem gleichen Problem befaßt, ist die Struktur der<br />
Verteilung notwendiges Resultat des Produktionsprozesses, mithin<br />
auch von Herrschaftsverhältnissen. Von beidem sieht Runciman ab.