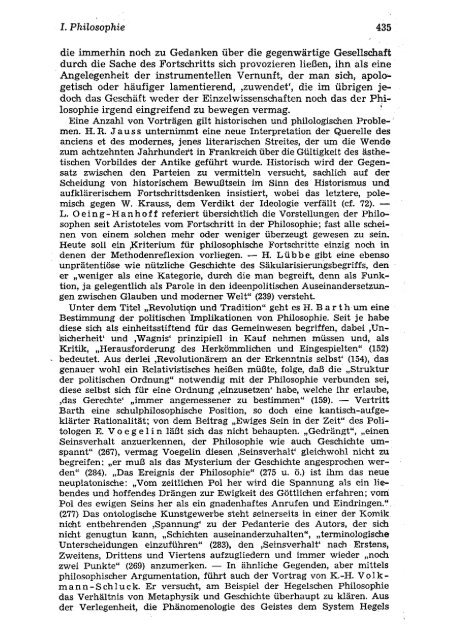Das Argument
Das Argument
Das Argument
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
I. Philosophie 435<br />
die immerhin noch zu Gedanken über die gegenwärtige Gesellschaft<br />
durch die Sache des Fortschritts sich provozieren ließen, ihn als eine<br />
Angelegenheit der instrumenteilen Vernunft, der man sich, apologetisch<br />
oder häufiger lamentierend, ,zu wendet', die im übrigen jedoch<br />
das Geschäft weder der Einzelwissenschaften noch das der Philosophie<br />
irgend eingreifend zu bewegen vermag.<br />
Eine Anzahl von Vorträgen gilt historischen und philologischen Problemen.<br />
H. R. Jaus s unternimmt eine neue Interpretation der Querelle des<br />
anciens et des modernes, jenes literarischen Streites, der um die Wende<br />
zum achtzehnten Jahrhundert in Frankreich über die Gültigkeit des ästhetischen<br />
Vorbildes der Antike geführt wurde. Historisch wird der Gegensatz<br />
zwischen den Parteien zu vermitteln versucht, sachlich auf der<br />
Scheidung von historischem Bewußtsein im Sinn des Historismus und<br />
aufklärerischem Fortschrittsdenken insistiert, wobei das letztere, polemisch<br />
gegen W. Krauss, dem Verdikt der Ideologie verfällt (cf. 72). —<br />
L. Oeing-Hanhoff referiert übersichtlich die Vorstellungen der Philosophen<br />
seit Aristoteles vom Fortschritt in der Philosophie; fast alle scheinen<br />
von einem solchen mehr oder weniger überzeugt gewesen zu sein.<br />
Heute soll ein ^Kriterium für philosophische Fortschritte einzig noch in<br />
denen der Methodenreflexion vorliegen. — H. Lübbe gibt eine ebenso<br />
unprätentiöse wie nützliche Geschichte des Säkularisierungsbegriffs, den<br />
er „weniger als eine Kategorie, durch die man begreift, denn als Funktion,<br />
ja gelegentlich als Parole in den ideenpolitischen Auseinandersetzungen<br />
zwischen Glauben und moderner Welt" (239) versteht.<br />
Unter dem Titel „Revolution und Tradition" geht es H. B a r t h um eine<br />
Bestimmung der politischen Implikationen von Philosophie. Seit je habe<br />
diese sich als einheitsstiftend für das Gemeinwesen begriffen, dabei ,Unisicherheit'<br />
und .Wagnis' prinzipiell in Kauf nehmen müssen und, als<br />
Kritik, „Herausforderung des Herkömmlichen und Eingespielten" (152)<br />
bedeutet. Aus derlei Revolutionärem an der Erkenntnis selbst' (154), das<br />
genauer wohl ein Relativistisches heißen müßte, folge, daß die „Struktur<br />
der politischen Ordnung" notwendig mit der Philosophie verbunden sei,<br />
diese selbst sich für eine Ordnung ,einzusetzen' habe, welche ihr erlaube,<br />
,das Gerechte' „immer angemessener zu bestimmen" (159). — Vertritt<br />
Barth eine schulphilosophische Position, so doch eine kantisch-aufgeklärter<br />
Rationalität; von dem Beitrag „Ewiges Sein in der Zeit" des Politologen<br />
E. Voegelin läßt sich das nicht behaupten. „Gedrängt", „einen<br />
Seinsverhalt anzuerkennen, der Philosophie wie auch Geschichte umspannt"<br />
(267), vermag Voegelin diesen .Seinsverhalt' gleichwohl nicht zu<br />
begreifen: „er muß als das Mysterium der Geschichte angesprochen werden"<br />
(284). „<strong>Das</strong> Ereignis der Philosophie" (275 u. ö.) ist ihm das neue<br />
neuplatonische: „Vom zeitlichen Pol her wird die Spannung als ein liebendes<br />
und hoffendes Drängen zur Ewigkeit des Göttlichen erfahren; vom<br />
Pol des ewigen Seins her als ein gnadenhaftes Anrufen und Eindringen."<br />
(277) <strong>Das</strong> ontologische Kunstgewerbe steht seinerseits in einer der Komik<br />
nicht entbehrenden ,Spannung' zu der Pedanterie des Autors, der sich<br />
nicht genugtun kann, „Schichten auseinanderzuhalten", „terminologische<br />
Unterscheidungen einzuführen" (283), den ,Seinsverhalt' nach Erstens*<br />
Zweitens, Drittens und Viertens aufzugliedern und immer wieder „noch<br />
zwei Punkte" (269) anzumerken. — In ähnliche Gegenden, aber mittels<br />
philosophischer <strong>Argument</strong>ation, führt auch der Vortrag von K.-H. Volkmann-Schluck.<br />
Er versucht, am Beispiel der Hegeischen Philosophie<br />
das Verhältnis von Metaphysik und Geschichte überhaupt zu klären. Aus<br />
der Verlegenheit, die Phänomenologie des Geistes dem System Hegels