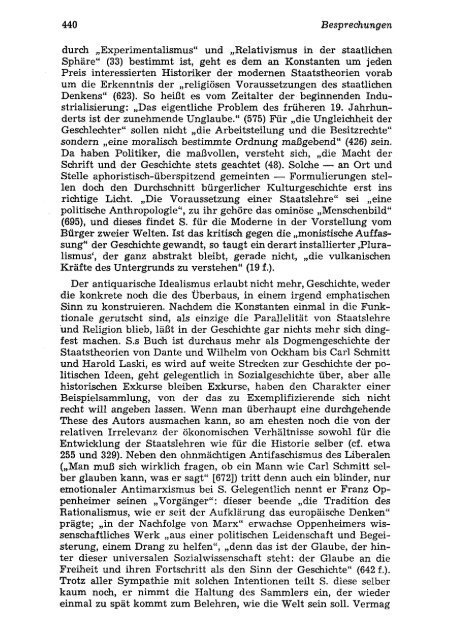Das Argument
Das Argument
Das Argument
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
440 •Besprechungen<br />
durch „Experimentalismus" und „Relativismus in der staatlichen<br />
Sphäre" (33) bestimmt ist, geht es dem an Konstanten um jeden<br />
Preis interessierten Historiker der modernen Staatstheorien vorab<br />
um die Erkenntnis der „religiösen Voraussetzungen des staatlichen<br />
Denkens" (623). So heißt es vom Zeitalter der beginnenden Industrialisierung:<br />
„<strong>Das</strong> eigentliche Problem des früheren 19. Jahrhunderts<br />
ist der zunehmende Unglaube." (575) Für „die Ungleichheit der<br />
Geschlechter" sollen nicht „die Arbeitsteilung und die Besitzrechte"<br />
sondern „eine moralisch bestimmte Ordnung maßgebend" (426) sein.<br />
Da haben Politiker, die maßvollen, versteht sich, „die Macht der<br />
Schrift und der Geschichte stets geachtet (48). Solche — an Ort und<br />
Stelle aphoristisch-überspitzend gemeinten — Formulierungen stellen<br />
doch den Durchschnitt bürgerlicher Kulturgeschichte erst ins<br />
richtige Licht. „Die Voraussetzung einer Staatslehre" sei „eine<br />
politische Anthropologie", zu ihr gehöre das ominöse „Menschenbild"<br />
(695), und dieses findet S. für die Moderne in der Vorstellung vom<br />
Bürger zweier Welten. Ist das kritisch gegen die „monistische Auffassung"<br />
der Geschichte gewandt, so taugt ein derart installierter,Pluralismus',<br />
der ganz abstrakt bleibt, gerade nicht, „die vulkanischen<br />
Kräfte des Untergrunds zu verstehen" (19 f.).<br />
Der antiquarische Idealismus erlaubt nicht mehr, Geschichte, weder<br />
die konkrete noch die des Überbaus, in einem irgend emphatischen<br />
Sinn zu konstruieren. Nachdem die Konstanten einmal in die Funktionale<br />
gerutscht sind, als einzige die Parallelität von Staatslehre<br />
und Religion blieb, läßt in der Geschichte gar nichts mehr sich dingfest<br />
machen. S.s Buch ist durchaus mehr als Dogmengeschichte der<br />
Staatstheorien von Dante und Wilhelm von Ockham bis Carl Schmitt<br />
und Harold Laski, es wird auf weite Strecken zur Geschichte der politischen<br />
Ideen, geht gelegentlich in Sozialgeschichte über, aber alle<br />
historischen Exkurse bleiben Exkurse, haben den Charakter einer<br />
Beispielsammlung, von der das zu Exemplifizierende sich nicht<br />
recht will angeben lassen. Wenn man überhaupt eine durchgehende<br />
These des Autors ausmachen kann, so am ehesten noch die von der<br />
relativen Irrelevanz der ökonomischen Verhältnisse sowohl für die<br />
Entwicklung der Staatslehren wie für die Historie selber (cf. etwa<br />
255 und 329). Neben den ohnmächtigen Antifaschismus des Liberalen<br />
(„Man muß sich wirklich fragen, ob ein Mann wie Carl Schmitt selber<br />
glauben kann, was er sagt" [672]) tritt denn auch ein blinder, nur<br />
emotionaler Antimarxismus bei S. Gelegentlich nennt er Franz Oppenheimer<br />
seinen „Vorgänger": dieser beende „die Tradition des<br />
Rationalismus, wie er seit der Aufklärung das europäische Denken"<br />
prägte; „in der Nachfolge von Marx" erwachse Oppenheimers wissenschaftliches<br />
Werk „aus einer politischen Leidenschaft und Begeisterung,<br />
einem Drang zu helfen", „denn das ist der Glaube, der hinter<br />
dieser universalen Sozial Wissenschaft steht: der Glaube an die<br />
Freiheit und ihren Fortschritt als den Sinn der Geschichte" (642 f.).<br />
Trotz aller Sympathie mit solchen Intentionen teilt S. diese selber<br />
kaum noch, er nimmt die Haltung des Sammlers ein, der wieder<br />
einmal zu spät kommt zum Belehren, wie die Welt sein soll. Vermag