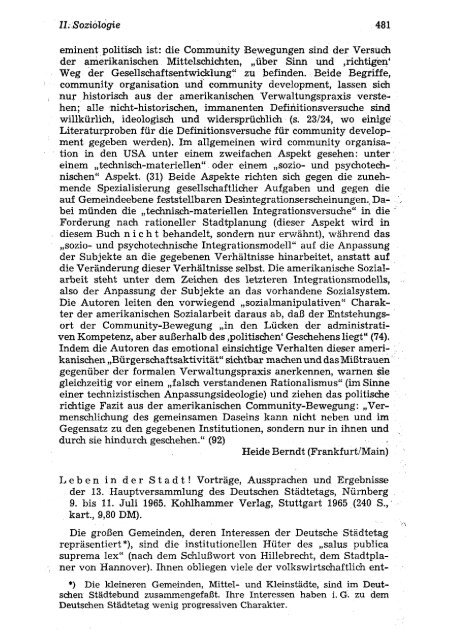Das Argument
Das Argument
Das Argument
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
II. Soziologie 481<br />
eminent politisch ist: die Community Bewegungen sind der Versuch<br />
der amerikanischen Mittelschichten, „über Sinn und ,richtigen'<br />
Weg der Gesellschaftsentwicklung" zu befinden. Beide Begriffe,<br />
community organisation und community development, lassen sich<br />
nur historisch aus der amerikanischen Verwaltungspraxis verstehen;<br />
alle nicht-historischen, immanenten Definitionsversuche sind<br />
willkürlich, ideologisch und widersprüchlich (s. 23/24, wo einige<br />
Literaturproben für die Definitionsversuche für community development<br />
gegeben werden). Im allgemeinen wird community organisation<br />
in den USA unter einem zweifachen Aspekt gesehen: unter<br />
einem „technisch-materiellen" oder einem „sozio- und psychotechnischen"<br />
Aspekt. (31) Beide Aspekte richten sich gegen die zunehmende<br />
Spezialisierung gesellschaftlicher Aufgaben und gegen die<br />
auf Gemeindeebene feststellbaren Desintegrationserscheinungen. Dabei<br />
münden die „technisch-materiellen Integrationsversuche" in die<br />
Forderung nach rationeller Stadtplanung (dieser Aspekt wird in<br />
diesem Buch nicht behandelt, sondern nur erwähnt), während das<br />
„sozio- und psychotechnische Integrationsmodell" auf die Anpassung<br />
der Subjekte an die gegebenen Verhältnisse hinarbeitet, anstatt auf<br />
die Veränderung dieser Verhältnisse selbst. Die amerikanische Sozialarbeit<br />
steht unter dem Zeichen des letzteren Integrationsmodells,<br />
also der Anpassung der Subjekte an das vorhandene Sozialsystem.<br />
Die Autoren leiten den vorwiegend „sozialmanipulativen" Charakter<br />
der amerikanischen Sozialarbeit daraus ab, daß der Entstehungsort<br />
der Community-Bewegung „in den Lücken der administrativen<br />
Kompetenz, aber außerhalb des politischen' Geschehens liegt" (74).<br />
Indem die Autoren das emotional einsichtige Verhalten dieser amerikanischen<br />
„Bürgerschaftsaktivität" sichtbar machen und das Mißtrauen<br />
gegenüber der formalen Verwaltungspraxis anerkennen, warnen sie<br />
gleichzeitig vor einem „falsch verstandenen Rationalismus" (im Sinne<br />
einer technizistischen Anpassungsideologie) und ziehen das politische<br />
richtige Fazit aus der amerikanischen Community-Bewegung: „Vermenschlichung<br />
des gemeinsamen <strong>Das</strong>eins kann nicht neben und im<br />
Gegensatz zu den gegebenen Institutionen, sondern nur in ihnen und<br />
durch sie hindurch geschehen." (92)<br />
Heide Berndt (Frankfurt/Main)<br />
Leben in der Stadt! Vorträge, Aussprachen und Ergebnisse<br />
der 13. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags, Nürnberg<br />
9. bis 11. Juli 1965. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1965 (240 S.,<br />
kart., 9,80 DM).<br />
Die großen Gemeinden, deren Interessen der Deutsche Städtetag<br />
repräsentiert*), sind die institutionellen Hüter des „salus publica<br />
suprema lex" (nach dem Schlußwort von Hillebrecht, dem Stadtplaner<br />
von Hannover). Ihnen obliegen viele der volkswirtschaftlich ent-<br />
*) Die kleineren Gemeinden, Mittel- und Kleinstädte, sind im Deutschen<br />
Städtebund zusammengefaßt. Ihre Interessen haben i. G. zu dem<br />
Deutschen Städtetag wenig progressiven Charakter.