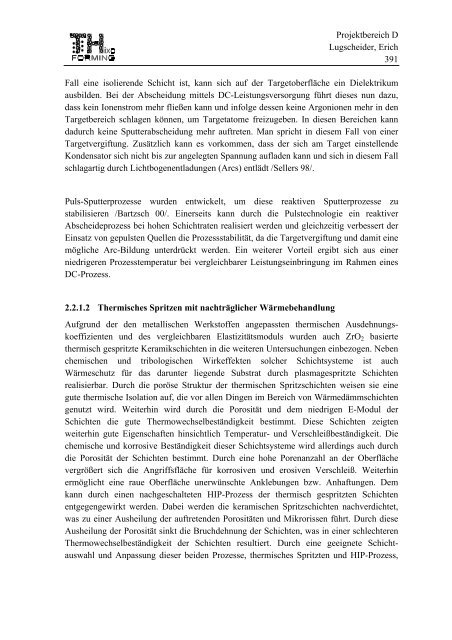Projektbereich D Lugscheider, Erich 383 Projektbereich D ... - SFB 289
Projektbereich D Lugscheider, Erich 383 Projektbereich D ... - SFB 289
Projektbereich D Lugscheider, Erich 383 Projektbereich D ... - SFB 289
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Projektbereich</strong> D<br />
<strong>Lugscheider</strong>, <strong>Erich</strong><br />
391<br />
Fall eine isolierende Schicht ist, kann sich auf der Targetoberfläche ein Dielektrikum<br />
ausbilden. Bei der Abscheidung mittels DC-Leistungsversorgung führt dieses nun dazu,<br />
dass kein Ionenstrom mehr fließen kann und infolge dessen keine Argonionen mehr in den<br />
Targetbereich schlagen können, um Targetatome freizugeben. In diesen Bereichen kann<br />
dadurch keine Sputterabscheidung mehr auftreten. Man spricht in diesem Fall von einer<br />
Targetvergiftung. Zusätzlich kann es vorkommen, dass der sich am Target einstellende<br />
Kondensator sich nicht bis zur angelegten Spannung aufladen kann und sich in diesem Fall<br />
schlagartig durch Lichtbogenentladungen (Arcs) entlädt /Sellers 98/.<br />
Puls-Sputterprozesse wurden entwickelt, um diese reaktiven Sputterprozesse zu<br />
stabilisieren /Bartzsch 00/. Einerseits kann durch die Pulstechnologie ein reaktiver<br />
Abscheideprozess bei hohen Schichtraten realisiert werden und gleichzeitig verbessert der<br />
Einsatz von gepulsten Quellen die Prozessstabilität, da die Targetvergiftung und damit eine<br />
mögliche Arc-Bildung unterdrückt werden. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus einer<br />
niedrigeren Prozesstemperatur bei vergleichbarer Leistungseinbringung im Rahmen eines<br />
DC-Prozess.<br />
2.2.1.2 Thermisches Spritzen mit nachträglicher Wärmebehandlung<br />
Aufgrund der den metallischen Werkstoffen angepassten thermischen Ausdehnungskoeffizienten<br />
und des vergleichbaren Elastizitätsmoduls wurden auch ZrO2 basierte<br />
thermisch gespritzte Keramikschichten in die weiteren Untersuchungen einbezogen. Neben<br />
chemischen und tribologischen Wirkeffekten solcher Schichtsysteme ist auch<br />
Wärmeschutz für das darunter liegende Substrat durch plasmagespritzte Schichten<br />
realisierbar. Durch die poröse Struktur der thermischen Spritzschichten weisen sie eine<br />
gute thermische Isolation auf, die vor allen Dingen im Bereich von Wärmedämmschichten<br />
genutzt wird. Weiterhin wird durch die Porosität und dem niedrigen E-Modul der<br />
Schichten die gute Thermowechselbeständigkeit bestimmt. Diese Schichten zeigten<br />
weiterhin gute Eigenschaften hinsichtlich Temperatur- und Verschleißbeständigkeit. Die<br />
chemische und korrosive Beständigkeit dieser Schichtsysteme wird allerdings auch durch<br />
die Porosität der Schichten bestimmt. Durch eine hohe Porenanzahl an der Oberfläche<br />
vergrößert sich die Angriffsfläche für korrosiven und erosiven Verschleiß. Weiterhin<br />
ermöglicht eine raue Oberfläche unerwünschte Anklebungen bzw. Anhaftungen. Dem<br />
kann durch einen nachgeschalteten HIP-Prozess der thermisch gespritzten Schichten<br />
entgegengewirkt werden. Dabei werden die keramischen Spritzschichten nachverdichtet,<br />
was zu einer Ausheilung der auftretenden Porositäten und Mikrorissen führt. Durch diese<br />
Ausheilung der Porosität sinkt die Bruchdehnung der Schichten, was in einer schlechteren<br />
Thermowechselbeständigkeit der Schichten resultiert. Durch eine geeignete Schichtauswahl<br />
und Anpassung dieser beiden Prozesse, thermisches Spritzten und HIP-Prozess,