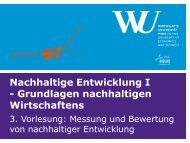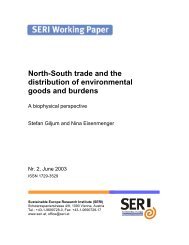Endbericht WeinKlim - SERI
Endbericht WeinKlim - SERI
Endbericht WeinKlim - SERI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WEINKLIM – Abschlussbericht März 2010 111<br />
Intensivierung des Inputbedarfs unumgänglich, sodass die Pflanzenproduktion unwirtschaftlich wird. Die<br />
Temperaturbedingungen und der Wasserhaushalt werden in Zukunft durch den Klimawandel deutliche<br />
Veränderungen erfahren. Je nachdem, wie nahe sich eine Kulturart in einem Anbaugebiet an ihrer<br />
spezifischen Empfindlichkeitsgrenze bei Hitze-, Kälte-, Trockenheits- oder Überflutungsstress befindet,<br />
müssen die Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel an die relevanteste Empfindlichkeit<br />
angepasst werden.<br />
Vorhersagen über das Ausmaß der wahrscheinlichen Änderungen von Klimaparametern erfordern den<br />
Einsatz regionaler Klimamodelle, da globale Modelle nicht die ausreichende Auflösung für<br />
kleinstrukturierte topographische Einheiten bieten. Für landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete<br />
Niederösterreichs wird mit einer Temperaturzunahme von 1,5-4,5 °C (Monatsmittel im Sommer) bzw.<br />
1,0-2,5 °C (Monatsmittel im Winter) für die Periode 2040-2060 gegenüber 1971-2005 gerechnet<br />
(Kromp-Kolb et al., 2007). In diesen Gebieten wird bezüglich der natürlichen Niederschläge für 2040-<br />
2060 mit Zunahmen der Monatssummen von 10-30 % in den Wintermonaten, mit Abnahmen von 10-30<br />
% in den Sommermonaten und weitgehend unveränderten Niederschlagssummen im Herbst und<br />
Frühjahr gerechnet.<br />
Der Weinbau zählt in Österreich zu den primär wärme-limitierten Kulturarten. Die erreichbaren<br />
Temperatursummen bestimmen sein derzeitiges Ausbreitungsgebiet und die Seehöhe, bis zu der Wein<br />
kultiviert wird. Der Großteil der Weinbaulagen Österreichs liegt daher in Ostösterreich tiefer als 400 m,<br />
und nur in besonderen Gunstlagen der Südsteiermark und Kärntens sind Weingärten bis 600 m zu<br />
finden. Dem war allerdings nicht immer so; aus historischen Quellen ist bekannt, dass Weinbau im<br />
späten Mittelalter noch im östlichen Waldviertel und im oberösterreichischen Alpenvorland anzutreffen<br />
war. Auch in den Alpengebieten zeigen heute noch gebräuchliche Rieden-Bezeichnungen wie<br />
"Weinberg" etc., dass in südexponierten Lagen vereinzelt bis auf 800 m Seehöhe Weinbau betrieben<br />
wurde, obwohl heutzutage dort nur mehr Grünlandnutzung vorkommt. Dies ändert allerdings nichts<br />
daran, dass auch damals die Wärmeansprüche der Weinrebe nicht jedes Jahr erfüllt wurden und<br />
Missernten, Frostschäden und aus heutiger Sicht unzureichende Produktqualitäten an der<br />
Tagesordnung standen (Löschnig und Stefl, 1935).<br />
Die Prognosen der regionalen Klimamodelle lassen auf den ersten Blick vermuten, dass die<br />
Temperatur-Probleme des Weinbaus in den Hintergrund rücken könnten und die Gefahr frostbedingter<br />
Ernteausfälle geringer wird. Ob diese Vermutung berechtigt ist, wird in weiterer Folge in diesem Bericht<br />
noch genauer untersucht. Es könnte aber auch zu befürchten sein, dass die Wasserlimitiertheit im<br />
Weinbau größere Bedeutung gewinnt. Einerseits scheint die Jahresniederschlagssumme nicht<br />
zuzunehmen (was zur Kompensation der Temperatur-Erhöhung erforderlich wäre), andererseits<br />
bedeutet die Verschiebung von Niederschlägen ins Winterhalbjahr, dass zur Zeit des größten<br />
Transpirationsbedarfs im Sommer weniger Wasser zur Verfügung steht. Davon leitet sich die<br />
Befürchtung ab, dass der Bewässerungsbedarf im Weinbau sich nicht nur auf die Etablierungsphase<br />
von Jungkulturen oder besonders steile Terrassenflächen beschränken wird, sondern in immer mehr<br />
Jahren auch ältere Kulturen von einer Bewässerung profitieren würden.<br />
Die Richtigkeit solcher Prognosen lässt sich genau genommen nur in der Zukunft verifizieren. Bis<br />
dorthin müssen solche Modellergebnisse als ernst zu nehmende Arbeitshypothesen gelten, denen eine<br />
inhärente Unsicherheit zu Eigen ist. Die Güte von Prognose-Modellen ist unter anderem an der<br />
Treffgenauigkeit bei der Simulation vergangener Klima-Entwicklungen zu erkennen. Die Arbeiten dieses<br />
Arbeitspakets konzentrierten sich daher primär auf der Untersuchung der lokalen Ausprägung bisheriger