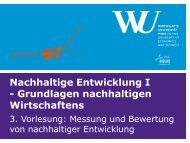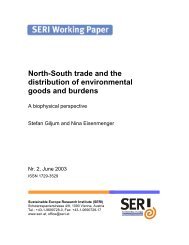Endbericht WeinKlim - SERI
Endbericht WeinKlim - SERI
Endbericht WeinKlim - SERI
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WEINKLIM – Abschlussbericht März 2010 140<br />
dieser unterschiedlichen Eigenschaften zur Erhöhung der Gesamtresistenz eines Weingartens<br />
könnte durch eine Mischung selektierter Klone bzw. Unterlagen erfolgen. Da unterschiedliche<br />
Umweltparameter zu Stressfaktoren werden können (z.B. Spätfrost, Hitze, UV B , Trockenheit),<br />
würde nicht nur eine bestimmte Resistenz gefordert sein, sondern eine Mischung mit<br />
unterschiedlichen Resistenzen würde im langfristigen Mittel die besten Ergebnisse für die<br />
Traubenproduktion ermöglichen. Die Aufgabe der Selektion liegt bei der Forschung und sollte<br />
nicht als abgeschlossen betrachtet werden, sondern einerseits noch mehr als bisher als<br />
Stressresistenz-Screening angelegt werden, andererseits offen für die Einbeziehung weiterer<br />
Zugänge in das Klon- bzw. Unterlagenspektrum sein. Das Zusammenspiel zwischen Unterlage<br />
und Edelreis und seine Abhängigkeit von den Umweltbedingungen, molekularbiologische<br />
Untersuchungen von generellen pflanzlichen Stressresistenz-Markern und die Identifikation von<br />
Weinreben-spezifischen Markern bieten der Forschung noch ein weites Betätigungsfeld.<br />
A 2. Typisierung vorhandener Klone in älteren Weingärten<br />
Die bereits bekannte Variabilität bei Stressresistenzen könnte noch erhöht werden, wenn in<br />
älteren Weingärten heute nicht mehr übliche Klone typisiert und charakterisiert würden. Selbst in<br />
bereits aufgelassenen Weingärten wurden in der Vergangenheit vereinzelt signifikante<br />
Entdeckungen gemacht, die zur Aufklärung von Sorten-Entstehungen geführt haben. Auf diese<br />
Weise könnten auch besondere Ausprägungen von Stressresistenzen identifiziert werden.<br />
A 3. Nutzung der biologischen Variabilität innerhalb der Sorten zur Auswahl wärmetoleranter Klone /<br />
Typen bezüglich geringen Säureverlusts in der Reifephase / höhere Säuregehalte<br />
Eine weitere Herausforderung liegt in der Selektion langsamer reifender Klone innerhalb der<br />
bestehenden Sorten, welche zwar einen höheren Wärmesummenbedarf haben, ansonsten aber<br />
nicht die bekannten Sortencharakteristika von z.B. Riesling oder Grüner Veltliner ändern.<br />
Einerseits könnte die spätere Ausreifung an sich die letzten Reifungsstadien in Perioden mit<br />
tieferen Nachttemperaturen und geringerem Säureabbau verlegen, andererseits könnte der<br />
geringere Säureabbau an sich als Kriterium selektiert werden, welches in wärmeren Phasen den<br />
Säureverlust langsamer ablaufen lässt. Dies würde auch durch höhere Säuregehalte in frühen<br />
Beerenreifungsstadien unterstützt werden.<br />
A 4. Ausweitung der Anbauzonen nach oben / Rückgewinnung historischer Weinbaulagen / Rieden<br />
Die frühere Erreichung der sortenspezifisch erforderlichen Wärmesummen könnte durch<br />
Verlegung in höher gelegene Rieden abgefangen werden, fallweise auch durch Einbeziehung<br />
bisher gemiedener Hangausrichtungen. Zwar bieten die Hügel westlich und östlich des unteren<br />
Traisentals keine Seehöhen, welche wesentlich höher als 400 m liegen, doch befinden sich in der<br />
Höhenstufe von etwa 300-380 m verschiedene Flächen, welche noch in historischen Zeiten als<br />
Weingärten genutzt worden sind. Aus vielen Quellen ist bekannt, dass der Weinbau in Österreich<br />
vom Spätmittelalter bis zum 16. Jahrhundert flächenmäßig wesentlich ausgedehnter war als<br />
heute. Diese Lagen waren durch die ungünstigeren klimatischen Bedingungen in der "kleinen<br />
Eiszeit" sowie durch neue Krankheiten und Schädlinge als wirtschaftliche und qualitätsmäßige<br />
Problemfälle aufgegeben worden. Dort liegt das Potential, auch im 21. Jahrhundert mit jenen<br />
Sorten Qualitätsernten einzufahren, wie sie im 20. Jahrhundert in den derzeit etablierten<br />
Weinbaurieden möglich waren. Allerdings erfordert eine derartige Ausweitung der derzeitigen<br />
Anbaufläche grundlegende agrarpolitische Weichenstellungen im Weinbaukataster und in der