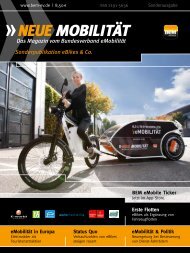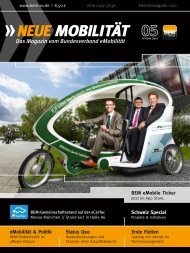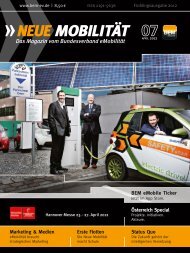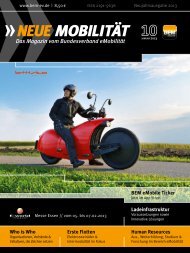NEUE MOBILITÄT 02
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
status quo der ELEKTRO<strong>MOBILITÄT</strong> - PHOENIX CONTACT<br />
Elektromobilität am Netz<br />
Integriertes Energiemanagement<br />
Wenn Elektromobilität auch im Massenmarkt zuverlässig funktionieren soll, ist eine umfassende Netzintegration erforderlich.<br />
Elektromobilität ist Chance und Herausforderung - für alle<br />
Beteiligten. Nur wenn die Integration der Elektrofahrzeuge<br />
in die Netze gelingt, kann Elektromobilität auch bei zunehmender<br />
Marktdurchdringung zuverlässig funktionieren und<br />
sich zum Vorteil für Nutzer und Netzbetreiber entwickeln.<br />
Für die Integration der Fahrzeuge in die Netze gibt es gute<br />
Gründe. Der Netzbetreiber muss sein Netz stabil halten.<br />
Durch gesteuertes Laden, zum Beispiel durch Tarifanreize,<br />
kann er die Ladezyklen auf Zeiten mit geringer Netzbelastung<br />
oder hohem Wind- oder Solarstrom-Aufkommen verlagern.<br />
Der Verantwortliche für den Energiebezug im Unternehmen<br />
möchte Lastspitzen vermeiden, die etwa durch elektromobile<br />
Pendler oder Flotten entstehen. Denn bei unkontrollierter<br />
Aufladung steigt das jeweilige Tagesmaximum, und damit<br />
der Leistungspreis, überproportional zur benötigten Fahrstrommenge,<br />
und damit zum Arbeitspreis. Der Betreiber einer<br />
PV-Anlage möchte - auch aufgrund der Neuregelung des<br />
EEG 2010 - möglichst viel von seinem Solarstrom selbst verbrauchen.<br />
Denn bei einem Eigenverbrauch von über 30 oder<br />
gar 50 Prozent winken zusätzliche Erlöse.<br />
Die Integration erfordert einheitliche Standards. Im Auftrag<br />
der Nationalen Plattform Elektromobilität wurde in einer<br />
branchenübergreifenden Zusammenarbeit die »Deutsche<br />
Normungsroadmap Elektromobilität« erstellt. Sie setzt auf<br />
Interoperabilität durch eine einheitliche Ladeinfrastruktur<br />
bei Ladetechnik, Schnittstellen und Abrechnung. Als vordringlich<br />
erachtet werden einheitliche Stecker - die NPE<br />
favorisiert den Typ 2 nach IEC 62196-2, das Laden im Mode<br />
3 als bevorzugte Ladevariante sowie die Kommunikation mit<br />
dem Smart Grid.<br />
Die Netzintegration erfolgt beispielsweise durch Anbindung<br />
an ein Energiemanagement-System über eine IT-Schnittstelle.<br />
Die Kompaktsteuerung der Ladestation greift über ein<br />
TCP/IP-Protokoll direkt auf eine SQL-Datenbank zu. Hat sich<br />
ein Nutzer identifiziert, werden seine Daten mit der Datenbank<br />
abgeglichen. Eine Steuerung überwacht die Ladeparameter<br />
vor Ort. Erkennt ein überlagertes Energiemanagement-<br />
System eine Änderung im Netz, werden die Ladeparameter<br />
angepasst.<br />
Über die gleiche Schnittstelle kann der Betreiber Diagnosedaten<br />
erfassen, die Auslastung abfragen und eine Wartung<br />
veranlassen. Programm- oder Prozessparameter werden aus<br />
der Ferne gewartet und modifiziert. Die durchgängige Kommunikation<br />
in die Feldebene mit gängigen IT- und Automatisierungs-Standards<br />
ermöglicht dann eine umfassende Integration<br />
der Ladeinfrastruktur in die Leitebene.<br />
Dipl.-Ing. Thorsten Temme<br />
Technology Management / Corporate Technology<br />
Phoenix Contact GmbH & Co. KG<br />
www.phoenixcontact.de/vorausschauend<br />
Neue Mobilität<br />
79