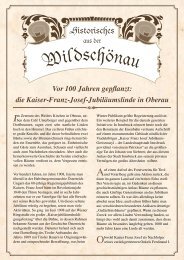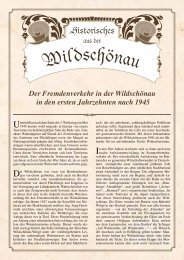8.2 Methodischer Ansatz am Beispiel „Winter 2002/03“ - Gemeinde ...
8.2 Methodischer Ansatz am Beispiel „Winter 2002/03“ - Gemeinde ...
8.2 Methodischer Ansatz am Beispiel „Winter 2002/03“ - Gemeinde ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Lawinenexperten vor Ort<br />
Diskussion<br />
9 Diskussion<br />
Täglich erkundigen sich Tausende von Lawinenkommissionären, Bergführern, Skitouristen<br />
u.a. nach den für die jeweilige Region erstellten Lawinenlagebericht. Vor allem für die<br />
Tourengeher ist er eine unentbehrliche Grundlage für die Tourenplanung. Die Qualität die-<br />
ser Prognose zu kontrollieren ist nicht einfach, denn anders, als bei der Wettervorhersage<br />
ist die prognostizierte Größe, die Lawinengefahrenstufe, nicht direkt messbar. Somit ist<br />
eine objektive Verifikation für viele Experten nicht messbar (Schweizer, 2003).<br />
Für den Schneesportler sind vor allem die Gefahrenstufen „gering“, „mäßig“ und „erheb-<br />
lich“ von Bedeutung. Hier gilt es, die Schneedeckenstabilität zu überprüfen. Je größer die<br />
Lawinengefahr ist, umso geringer ist die Schneedeckenstabilität. Gemäß Definition von<br />
Stufe 2 („mäßig“) ist „... die Schneedecke an einigen Steilhängen nur mäßig verfestigt,<br />
ansonsten allgemein gut verfestigt.“ Größere spontane Lawinen sind nicht zu erwarten,<br />
aber Schneesportler können durchaus vereinzelt noch Schneebrettlawinen auslösen. Dies<br />
objektiv zu messen scheint schier unmöglich zu sein. Die Stufen „große“ und „sehr große<br />
Lawinengefahr“ lassen sich <strong>am</strong> ehesten im Nachhinein über die abgegangenen Lawinen<br />
verifizieren.<br />
Da man „im Nachhinein (fast) immer klüger ist“ und dann meist über zusätzliche Daten<br />
und Beobachtungen verfügt, ist eine rückblickende Einschätzung möglich. Diese muss<br />
zwangsläufig aber auch nicht immer eindeutig und richtig sein (Schweizer, 2003).<br />
Idealerweise geschieht diese Art der Verifikation durch unabhängige Experten, also nicht<br />
durch die Prognostiker selbst. Eine Überprüfung bzw. Korrektur des Lageberichts durch<br />
Bergführer oder erfahrene Tourengeher vor Ort und tägliche Rückmeldungen an die Prog-<br />
nostiker sind Bausteine für aussagekräftige Resultate und künftig optimierte Prognosen.<br />
Insbesondere nach längeren Perioden ohne nennenswerten Schneefall ist die Verifikation<br />
ungleich schwieriger. Bestimmte Anzeichen wie „Wummgeräusche“ oder „Fernauslösun-<br />
gen“ deuten auf Gefahrenstufe 3 („erheblich“) hin. Bei Ausbleiben derselben „Alarmzei-<br />
chen“ kann aber keinesfalls automatisch auf eine geringere Gefahrenstufe geschlossen<br />
werden, wie auch vereinzelte Fernauslösungen noch nicht automatisch Stufe 3 bedeuten.<br />
Schweizer (2003) hält fest „ ...dass die Gefahrenstufen durch die Auslösewahrscheinlich-<br />
keit (natürliche Schneedeckenstabilität und menschliches Einwirken), die flächige Vertei-<br />
lung der Gefahrenstellen und die Größe und Art der Lawinen (Mächtigkeit der abgleiten-<br />
Alexander Holaus Seite 92