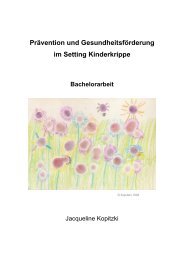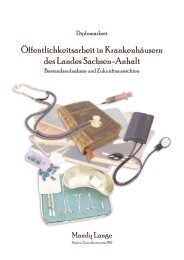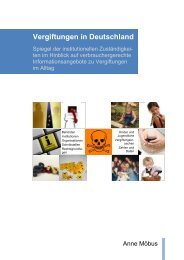Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3. Kapitel – Theoretischer Hintergr<strong>und</strong><br />
3 THEORETISCHER HINTER-<br />
GRUND<br />
3.1 Begriffliche Bestimmung <strong>sozial</strong>er<br />
Benachteiligung<br />
Der Begriff der <strong>sozial</strong>en Benachteiligung<br />
ist eng mit den Theorien <strong>sozial</strong>er<br />
Ungleichheit <strong>und</strong> dessen Erscheinungsformen<br />
verknüpft (vgl. Krüger & Rauschenbach<br />
2004).<br />
Nach Hradil (1999) liegt <strong>sozial</strong>e<br />
Ungleichheit dann vor, „[…] wenn Menschen<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer Stellung in <strong>sozial</strong>en<br />
Beziehungsgefügen von den ‚wertvollen<br />
Gütern’ einer Gesellschaft regelmäßig<br />
mehr als andere erhalten“ (S.<br />
26). Je mehr folglich ein Einzelner von<br />
diesen „wertvollen Gütern“ besitzt, umso<br />
besser gestalten sich seine Lebensbedingungen.<br />
Derartige Güter werden<br />
da<strong>bei</strong> aufgr<strong>und</strong> allgemeingültiger Wertvorstellungen,<br />
wie z.B. Wohlstand oder<br />
Sicherheit definiert <strong>und</strong> stellen die Bedingungen<br />
zur Erlangung gesellschaftlicher<br />
Zielvorstellungen dar (vgl. ebenda).<br />
Jedoch werden ausschließlich gesellschaftlich<br />
strukturierte, beständige<br />
sowie verallgemeinerbare Phänomene<br />
als Erscheinungsformen <strong>sozial</strong>er Ungleichheit<br />
definiert. Nicht berücksichtigt<br />
werden natürliche, individuelle, zufällige<br />
<strong>und</strong> momentane Ungleichheiten, wo<strong>bei</strong><br />
jene dennoch mit <strong>sozial</strong>en Ungleichheiten<br />
zusammenwirken sowie auf vielfältige<br />
Weise verknüpft sind (vgl. Hradil<br />
1999).<br />
Um die verschiedenen Dimensionen<br />
<strong>sozial</strong>er Ungleichheit nachvollziehbar<br />
<strong>und</strong> handhabbar zu machen, wurden<br />
diese anhand von Kategorien zusammengefasst.<br />
Hradil (1999) beschreibt<br />
z.B. materiellen Wohlstand,<br />
Macht, Prestige <strong>und</strong> Bildung als die vier<br />
Basisdimensionen <strong>sozial</strong>er Ungleich-<br />
10<br />
heit. Auch Mielck (2000) verdeutlicht,<br />
dass „[…] unter dem Begriff ‚<strong>sozial</strong>e<br />
Ungleichheit’ zumeist Unterschiede<br />
nach Bildung, beruflichem Status <strong>und</strong><br />
Einkommen verstanden“ werden (S.<br />
18). Es handelt sich hier<strong>bei</strong> um Merkmale<br />
der vertikalen <strong>sozial</strong>en Ungleichheit,<br />
was bedeutet, dass der sozioökonomische<br />
Status von Personen mittels<br />
Angaben zu Bildung, Beruf <strong>und</strong><br />
Einkommen erfasst werden kann <strong>und</strong><br />
folglich eine Einteilung der Bevölkerung<br />
in oben <strong>und</strong> unten ermöglicht wird (vgl.<br />
Mielck 2000).<br />
Bis in die 70er Jahre hinein wurde<br />
zur Einordnung der Gesellschaft in hierarchische<br />
Strukturen der Begriff der<br />
<strong>sozial</strong>en Schichten verwendet. Schichten<br />
werden da<strong>bei</strong> als „Gruppierungen<br />
von Menschen mit ähnlich hohem Status<br />
innerhalb einer oder mehrerer berufsnaher<br />
Ungleichheitsdimensionen“<br />
bezeichnet (Berger & Hradil 1990, S.<br />
3). Im Vordergr<strong>und</strong> standen da<strong>bei</strong><br />
hauptsächlich beruflich vermittelte Ressourcen<br />
als Ungleichheitsphänomene,<br />
da der Beruf im Zuge der Industriegesellschaft<br />
als <strong>sozial</strong>e Schlüsselposition<br />
galt.<br />
Im Laufe der 70er Jahre distanzierte<br />
sich die Sozialwissenschaft jedoch<br />
immer mehr von dieser einseitigen<br />
ökonomischen Ausrichtung <strong>und</strong> somit<br />
vom Schichtenkonzept, da sich gesellschaftliche<br />
Wert- <strong>und</strong> Zielvorstellungen<br />
über berufliche Güter hinaus entwickelten<br />
<strong>und</strong> andere Dimensionen (z.B.<br />
Wohn-, Freizeit-, Umweltbedingungen)<br />
an Relevanz gewannen (vgl. Hradil<br />
1999).<br />
Aufgr<strong>und</strong> wohlfahrtsstaatlicher Instanzen<br />
<strong>und</strong> soziokultureller Faktoren (z.B.<br />
Ausgrenzung von Ausländern) wurden<br />
neben den vertikalen Erscheinungsformen<br />
<strong>sozial</strong>er Ungleichheit zunehmend