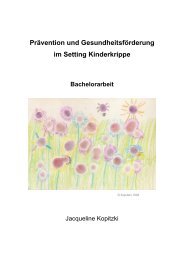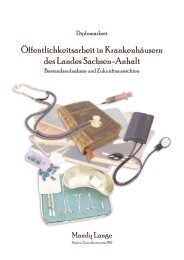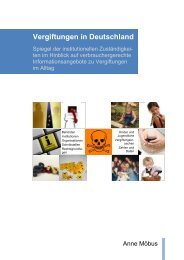Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Kapitel – Theoretischer Hintergr<strong>und</strong><br />
3.2 Der Zusammenhang <strong>sozial</strong>er<br />
<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher Benachteiligung<br />
Zahlreiche Studien belegen, dass <strong>sozial</strong>e<br />
<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitliche Benachteiligung<br />
im Zusammenhang zueinander<br />
stehen. Bereits Anfang der 80er Jahre<br />
wurde aufgr<strong>und</strong> einer umfassenden<br />
Forschungsar<strong>bei</strong>t aus Großbritannien,<br />
dem so genannten „Black Report“<br />
nachgewiesen, dass <strong>sozial</strong> benachteiligte<br />
Personen von einer besonders<br />
hohen Mortalität sowie Morbidität betroffen<br />
sind. Viele nachfolgende Studien,<br />
wie z.B. die „Whitehall Study“ sowie<br />
„Whitehall II“ belegen, dass eine<br />
höhere Mortalität insbesondere mit einem<br />
niedrigen beruflichen Status verb<strong>und</strong>en<br />
ist (vgl. Mielck 2003b).<br />
Zur Ermittlung ges<strong>und</strong>heitlich benachteiligter<br />
Gruppen spielen da<strong>bei</strong> in<br />
erster Linie die vertikalen Merkmale<br />
<strong>sozial</strong>er Ungleichheit eine Rolle, da<br />
anhand der Indikatoren: Bildung, Einkommen<br />
<strong>und</strong> Beruf der sozioökonomische<br />
Status einer Person erfasst<br />
werden kann. Dieses Konzept der<br />
Ressourcenarmut wird verwendet, weil<br />
messbare Indikatoren für Lebenslagen<br />
derzeit noch fehlen (vgl. SLfG 2005).<br />
Folglich werden ges<strong>und</strong>heitlich Benachteiligte<br />
mittels Armutskriterien wie z.B.<br />
der Sozialhilfe bestimmt. Doch erst in<br />
Kombination mit Merkmalen der horizontalen<br />
Ungleichheit können besonders<br />
belastete Bevölkerungsgruppen so<br />
genau wie möglich beschrieben werden<br />
(vgl. Mielck 2003a).<br />
Ähnlich wie in Großbritannien, sind<br />
auch in Deutschland besonders die<br />
unteren Statusgruppen von Krankheit<br />
<strong>und</strong> frühem Tod betroffen. Die Mortalität<br />
ist da<strong>bei</strong> in den unteren Einkommensgruppen<br />
höher als in den oberen,<br />
12<br />
z.B. haben Erwachsene ohne Abitur<br />
eine kürzere Lebenserwartung als Erwachsene<br />
mit Abitur, wo<strong>bei</strong> der Unterschied<br />
in der Lebensdauer <strong>bei</strong> Männern<br />
etwa 3,3 <strong>und</strong> <strong>bei</strong> Frauen ca. 3,9 Jahre<br />
beträgt. Auch hinsichtlich der Morbidität<br />
lassen sich Unterschiede feststellen.<br />
Beispielsweise erleiden Männer <strong>und</strong><br />
Frauen, die eine geringe schulische<br />
<strong>und</strong> berufliche Bildung aufweisen, öfter<br />
einen Herzinfarkt als Erwachsene mit<br />
Abitur. Bei der Frage nach dem allgemeinen<br />
Wohlbefinden antworten Personen<br />
der unteren Statusgruppen häufiger<br />
mit „schlecht“ als Personen der<br />
oberen Statusgruppen. Im Vergleich zu<br />
den oberen Einkommensgruppen ist die<br />
Mortalität in den Unteren zwei- bis<br />
dreimal größer (vgl. ebenda).<br />
Jedoch sind die unteren Statusgruppen<br />
nicht durch „ihre große Verelendung“<br />
vom Rest der Gesellschaft<br />
abgegrenzt. Vielmehr existiert ein <strong>sozial</strong>er<br />
Gradient, was bedeutet, dass<br />
sich ges<strong>und</strong>heitliche Ungleichheiten<br />
durch die gesamte Bevölkerungsstruktur<br />
ziehen. Je niedriger sich da<strong>bei</strong> der<br />
sozio-ökonomische Status einer Person<br />
darstellt, desto höher ist deren Morbiditäts-<br />
<strong>und</strong> Mortalitätsrisiko (vgl. Marmot<br />
& Wilkinson 1999). Vor allem Krankheitsbilder<br />
<strong>und</strong> Todesursachen, wie<br />
z.B. koronare Herzkrankheiten, Schlaganfall,<br />
Herzinsuffizienz, Bronchialkarzinom,<br />
Diabetes mellitus, Depression,<br />
Atemwegserkrankungen, AIDS sowie<br />
tödlich verlaufende Unfälle sind mit einem<br />
derartigen <strong>sozial</strong>en Gradienten<br />
verb<strong>und</strong>en (vgl. Siegrist & Joksimovic<br />
2000).