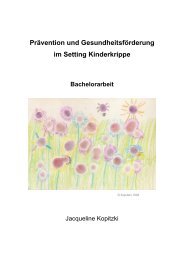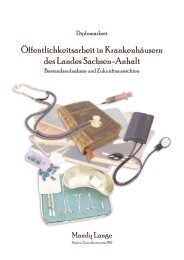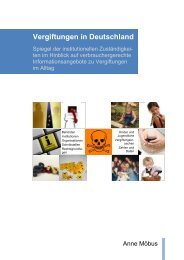Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Kapitel – Theoretischer Hintergr<strong>und</strong><br />
gründeten Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsmaßnahmen,<br />
die über die Beeinflussung<br />
des individuellen <strong>und</strong> kollektiven<br />
Verhaltens des Menschen zur Förderung,<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Wiederherstellung<br />
seiner Ges<strong>und</strong>heit <strong>bei</strong>trägt, in ihm die<br />
Verantwortung für seine eigene Ges<strong>und</strong>heit<br />
festigt <strong>und</strong> ihn befähigt, aktiv<br />
an der Gestaltung der natürlichen <strong>und</strong><br />
gesellschaftlichen Umwelt teilzunehmen“<br />
(vgl. WHO 1993a).<br />
Schulische <strong>Prävention</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitserziehung<br />
ist da<strong>bei</strong> auf die<br />
Vermeidung von Krankheiten ausgerichtet.<br />
Risikofaktoren, wie z.B. Bewegungsmangel,<br />
Nikotin- oder Alkoholabhängigkeit<br />
sowie Ernährungsdefizite<br />
sollen durch eine gezielte Wissensvermittlung<br />
aufgedeckt <strong>und</strong> begrenzt bzw.<br />
beseitigt werden (vgl. Bauch 2000).<br />
Zwar konnte mittels ges<strong>und</strong>heitserzieherischer<br />
Maßnahmen vor allem die<br />
Bekämpfung von Zahnkaries <strong>und</strong> die<br />
Verdrängung infektiöser Kinderkrankheiten<br />
vorangetrieben werden (vgl.<br />
Achermann et al. 2004), jedoch fanden<br />
diese insgesamt im schulischen Alltag<br />
nur in untergeordneter Weise Berücksichtigung<br />
(vgl. Rothenfluh 1992). Ges<strong>und</strong>heitserziehung<br />
ist hauptsächlich<br />
von der persönlichen Initiative des einzelnen<br />
Lehrers abhängig <strong>und</strong> wird häufig<br />
aus Gründen von Zeitnot oder Stoffdruck<br />
hinten angestellt <strong>und</strong> nicht in ausreichendem<br />
Maße berücksichtigt (ebenda).<br />
Nach Dietrich <strong>und</strong> Müller<br />
(1980, zitiert nach Rothenfluh 1992)<br />
vertritt die Mehrheit der Lehrkräfte die<br />
Meinung, dass ges<strong>und</strong>heitliche Erziehung<br />
vorwiegend dem Aufgabenbereich<br />
der Eltern zuzuordnen ist. Laut Vuille et<br />
al. (2004) wird diese von den Unterrichtenden<br />
eher als Überforderung empf<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> nur widerwillig in den eigenen<br />
Unterrichtsplan integriert. Auch die<br />
26<br />
Tatsache, dass Ges<strong>und</strong>heitserziehung<br />
fächerübergreifend angelegt ist <strong>und</strong><br />
keine konkrete Verortung aufweist, trägt<br />
zu einer gewissen Unverbindlichkeit<br />
ihres Einsatzes <strong>bei</strong> (vgl. von Haug<br />
1991). Aus diesen Gründen wurden von<br />
verschiedenen Seiten Forderungen<br />
hinsichtlich der Einführung eines eigenständigen<br />
Schulfachs „Ges<strong>und</strong>heitserziehung“<br />
laut, jedoch angesichts des<br />
interdisziplinären Charakters von Ges<strong>und</strong>heit<br />
wieder verworfen (vgl. Achermann<br />
et al. 2004).<br />
Als zu Beginn der 90er Jahre diverse<br />
Untersuchungen die massive<br />
Verschlechterung des Ges<strong>und</strong>heitsverhaltens<br />
von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
seit den 80er Jahren publizierten, entstanden<br />
zunehmend Zweifel an der<br />
Wirksamkeit schulischer Ges<strong>und</strong>heitserziehung.<br />
Besonders eine amerikanische<br />
Studie des Nationalen Krebsinstituts<br />
aus dem Jahre 1984 stellt eindrucksvoll<br />
deren Unwirksamkeit dar.<br />
Vierzig Schulen wurden randomisiert<br />
einer Interventions- bzw. einer Kontrollgruppe<br />
zugeteilt. Über zehn Jahre fanden<br />
in den Interventionsschulen verstärkt<br />
Maßnahmen zur Raucherprävention<br />
statt, die den neusten Richtlinien<br />
entsprachen. Nach zwölf Jahren konnten<br />
noch 94% der ursprünglich Teilnehmenden<br />
untersucht werden: es<br />
rauchten 28,4% der Schüler der Interventionsschulen<br />
im Vergleich zu 29,1%<br />
der Kontrollschulen (vgl. Peterson et al.<br />
2000).<br />
Folglich wird deutlich, dass durch<br />
die bloße Wissensvermittlung keine<br />
Verhaltensänderung induziert ist. V.<br />
Troschke (1993) kritisiert insbesondere<br />
die präventiv-medizinische Orientierung<br />
der Ges<strong>und</strong>heitserziehung <strong>und</strong> ihre<br />
defizitäre Ausrichtung an Krankheiten,<br />
Risikofaktoren <strong>und</strong> Noxen. Außerdem