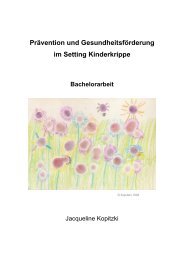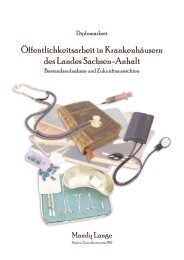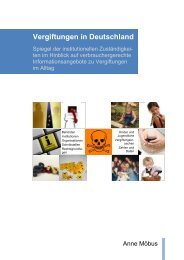Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Kapitel – Theoretischer Hintergr<strong>und</strong><br />
Süd- als auch ein Ost-West-Gefälle<br />
beobachtet werden, denn während in<br />
Bayern bzw. Baden-Württemberg die<br />
Jugendar<strong>bei</strong>tslosigkeit im Jahr 2000<br />
weniger als 5% beträgt, liegt sie in Niedersachsen<br />
oder Bremen zwischen 10<br />
<strong>und</strong> 15% <strong>und</strong> in den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
zwischen 16 <strong>und</strong> 21% (vgl.<br />
BMFSFJ 2002).<br />
Soziale Benachteiligung verfestigt<br />
sich häufig über Generationen hinweg<br />
(vgl. Walper 1997), man könnte folglich<br />
von einer „Vererbung“ <strong>sozial</strong>er Benachteiligung<br />
sprechen. Beispielsweise beschreiben<br />
Mayer <strong>und</strong> Blossfeld (1990)<br />
in diesem Kontext, eine generationsübergreifende<br />
Verfestigung des beruflichen<br />
Status.<br />
Hier wird deutlich, welchen Einfluss<br />
die Familie auf die Ausbildung <strong>und</strong> Verankerung<br />
<strong>sozial</strong>er Benachteiligungen<br />
ausübt. In unterprivilegierten Familien<br />
bzw. familienähnlichen Gemeinschaften<br />
fehlen zumeist stabile emotionale Bezugssysteme<br />
sowie ein stützendes Klima.<br />
Außerdem erfahren benachteiligte<br />
Jugendliche aufgr<strong>und</strong> der familiären<br />
Situation einen eingeschränkteren Aktivitäts-<br />
<strong>und</strong> Aktionsraum als auch geringere<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Anregung (vgl.<br />
Seus-Seberich 2005), denn der Wert<br />
von Bildung wird nicht, wie in bildungsnahen<br />
Haushalten als Selbstverständlichkeit<br />
gelebt, sondern der Bildungsbezug<br />
bleibt angestrengt <strong>und</strong> instrumentell<br />
(vgl. Gill 2005). Insgesamt ist die<br />
Problemdichte in <strong>sozial</strong> <strong>benachteiligten</strong><br />
Familien besonders ausgeprägt <strong>und</strong><br />
<strong>bei</strong>spielsweise durch existenzielle Versorgungsmängel<br />
(z.B. unzureichende<br />
Wohnverhältnisse, schlechte Ernährung,<br />
Verschuldung), familiäre Konflikte,<br />
der Abwesenheit eines Elternteils<br />
sowie durch Gewalt-, Sucht- <strong>und</strong>/oder<br />
Kriminalitätserfahrungen geprägt (vgl.<br />
18<br />
BMBF 2002). Horstkotte (2003) beschreibt<br />
in diesem Zusammenhang,<br />
dass ein großer Teil der Jugendlichen<br />
aus <strong>sozial</strong> <strong>benachteiligten</strong> Familien in<br />
der Regel bereits verschiedenste Interventionsmaßnahmen<br />
wie schulische<br />
Fördermaßnahmen, kinderpsychiatrische<br />
Behandlungen, Fremdplatzierung<br />
etc. durchlaufen haben. Diese ungünstigen<br />
Entwicklungsbedingungen beeinflussen<br />
natürlich Normen <strong>und</strong> Verhaltensweisen,<br />
Lebensstil, Wohnbedingungen<br />
<strong>und</strong> Bildungsverlauf der Jugendlichen<br />
in hohem Maße (vgl. BMBF<br />
2002). Die Heranwachsenden machen<br />
sich da<strong>bei</strong> die ihnen vorgelebten Lebensstile<br />
<strong>und</strong> Handlungsstrategien zu<br />
eigen. Sie lernen gesellschaftliche Basiskompetenzen<br />
häufig überhaupt nicht<br />
kennen.<br />
Auch durch die Sozialisationsinstitution<br />
Schule wird die Benachteiligung<br />
unzureichend gemildert, sondern eher<br />
verstärkt. Die PISA-Studie belegt, dass<br />
die Kompetenzdefizite benachteiligter<br />
Jugendlicher durch den hohen Leistungsdruck<br />
sowie durch die Segregation<br />
in „schulformspezifische Milieus“ die<br />
<strong>sozial</strong>en Ungleichheiten weiter verfestigen,<br />
denn in den geschaffenen homogenen<br />
Lernumgebungen können benachteiligte<br />
Schüler kaum voneinander<br />
lernen, sondern werden in ihrem Kompetenzerwerb<br />
zusätzlich benachteiligt<br />
(vgl. Schumann 2003).<br />
Jedoch existieren länderspezifische<br />
Unterschiede hinsichtlich der<br />
Ausprägungen <strong>sozial</strong>er Benachteiligung<br />
sowie der Rahmenbedingungen für<br />
schulisches Lernen. Beispielsweise<br />
reichen die Anteile Jugendlicher mit<br />
Migrationshintergr<strong>und</strong> von r<strong>und</strong> 3% in<br />
Thüringen bis etwa 40% in Bremen <strong>und</strong><br />
Hamburg. Des Weiteren haben Heranwachsende<br />
verschiedene Ausgangsbe-