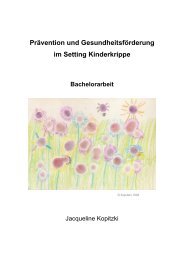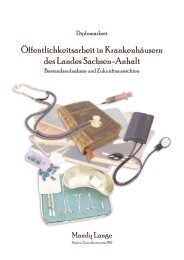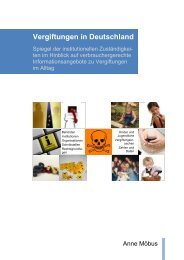Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7. Kapitel – Diskussion<br />
zu verfolgen ist, da beträchtliche Unterschiede<br />
hinsichtlich des Wohlbefindens<br />
sowie ges<strong>und</strong>heitlicher Verhaltensweisen<br />
zwischen den Geschlechtern existieren<br />
(vgl. Höfer 2000, Kolip 2002).<br />
Seitens einzelner Akteure wird darauf<br />
hingewiesen, dass in berufsbildenden<br />
Schulen mittels eines fachbezogenen<br />
Zugangs häufig bereits auf eine „Geschlechterentmischung“<br />
zurückgegriffen<br />
werden kann (vgl. S. 47).<br />
Außerdem weisen die Befragten<br />
ausdrücklich darauf hin, dass auf die<br />
Niedrigschwelligkeit der Ansätze (vgl.<br />
Pott & Lehmann 2002) geachtet werden<br />
muss. Die Konzepte sollten sehr praxisorientiert<br />
ausgerichtet sein <strong>und</strong> auf<br />
zuviel Theorie- <strong>und</strong> Wissensvermittlung<br />
verzichten. Die Akteure bevorzugen in<br />
diesem Zusammenhang vor allem erlebnispädagogische<br />
Strategien, welche<br />
vornehmlich in Team- bzw. Gruppenform<br />
erfolgen <strong>und</strong> die Erweiterung von<br />
<strong>sozial</strong>en <strong>und</strong> persönlichen Kompetenzen<br />
bezwecken. Durch diese Vorgehensweise<br />
sollen Jugendliche über den<br />
Ansatz des Erlebens, des aktiven Handelns<br />
– bestenfalls in der Gruppe –<br />
„spielerisch“ im Erwerb von Lebenskompetenzen<br />
unterstützt werden (vgl.<br />
S. 47; 49).<br />
Überdies verdeutlichen die Akteure,<br />
dass sich ebenfalls die Auswahl der in<br />
den Projekten zu thematisierenden<br />
Schwerpunktbereiche entscheidend auf<br />
den Erfolg der Intervention auswirkt<br />
(vgl. S. 49). Projektthemen müssen für<br />
die Zielgruppe interessant erscheinen<br />
<strong>und</strong> folglich lebensweltspezifisch ansetzen.<br />
Da<strong>bei</strong> ist es wichtig, die Schwerpunkte<br />
nicht einzeln <strong>und</strong> zusammenhangslos<br />
zu betrachten sondern Probleme<br />
als auch Interessen der Jugendlichen<br />
zu bündeln (vgl. Langness et al.<br />
2003). Eine geeignete Strategie stellt<br />
56<br />
hier z.B. die aktive Einbeziehung der<br />
Zielgruppe bereits <strong>bei</strong> der Projektplanung<br />
dar. Ergänzend wird auf eine Art<br />
„Huckepackverfahren“ hingewiesen.<br />
Ges<strong>und</strong>heit wird da<strong>bei</strong> anhand für die<br />
Zielgruppe relevanter Themen transportiert.<br />
Von hoher Relevanz ist ebenfalls<br />
die Sicherung der Nachhaltigkeit der<br />
Maßnahmen. Hier befürwortet die<br />
Mehrheit der Interviewpartner die Schulung<br />
von Multiplikatoren, da durch diesen<br />
Ansatz die zentralen Prinzipien der<br />
durchgeführten Intervention erhalten<br />
bleiben als auch fortgesetzt werden<br />
können (vgl. S. 49). Bezüglich <strong>sozial</strong><br />
benachteiligter Zielgruppen weisen einzelne<br />
Akteure insbesondere darauf hin,<br />
den Einfluss der Peer Groups zu nutzen<br />
<strong>und</strong> vorwiegend Schülermultiplikatoren,<br />
<strong>bei</strong>spielsweise als Streitschlichter<br />
auszubilden (vgl. S. 49). Weiterhin verdeutlichen<br />
die Projektträger, dass ebenfalls<br />
die Initiierung von Netzwerken sowie<br />
Kooperationen zur Sicherung der<br />
Nachhaltigkeit (vgl. Pinquart & Silbereisen<br />
2004; Pott & Lehmann 2002) <strong>bei</strong>tragen<br />
können. Hinsichtlich berufsbildender<br />
Schulen könnten z.B. verstärkt<br />
Kooperationen einerseits mit allgemeinbildenden<br />
Schulen sowie andererseits<br />
mit Betrieben geschaffen werden,<br />
um insbesondere <strong>benachteiligten</strong><br />
Schülern fließende Übergänge zu ermöglichen<br />
bzw. sie in der Berufsorientierung<br />
zu unterstützen (vgl. S. 47; 49).<br />
Außerdem sind sich die befragten<br />
Einrichtungen einig, dass alle Projekte<br />
ausreichenden Evaluationen (vgl. S.<br />
49) unterzogen werden sollten, um<br />
Schwierigkeiten vorzeitig zu korrigieren<br />
bzw. einen Transfer auf andere Rahmenbedingungen<br />
zu ermöglichen.