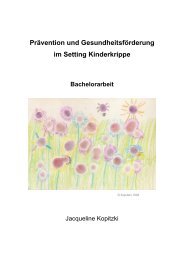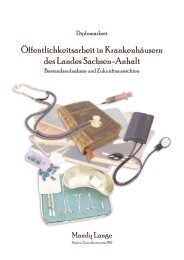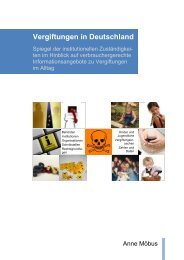Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3. Kapitel – Theoretischer Hintergr<strong>und</strong><br />
zenverbände der Krankenkassen 2003,<br />
S. 7). Ferner geht auch aus den Expertisen<br />
(Gutachten 2000/2001: „Bedarfsgerechtigkeit<br />
<strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit“,<br />
Gutachten 2005: „Koordination <strong>und</strong><br />
Qualität im Ges<strong>und</strong>heitswesen“) des<br />
Sachverständigenrates für die Begutachtung<br />
der Entwicklung im Ges<strong>und</strong>heitswesen<br />
hervor, dass mittels des<br />
Setting-Ansatzes unterschiedlichste<br />
Zielgruppen vergleichsweise einfach als<br />
auch unter Vermeidung unerwünschter<br />
Stigmatisierungseffekte erreicht werden<br />
können (vgl. SVR 2005; SVR 2000/01).<br />
Allerdings bezweifelt Bauch (2002) die<br />
<strong>sozial</strong>kompensatorische Wirksamkeit<br />
des Setting-Ansatzes, da Nicht-Benachteiligte<br />
genauso erreicht werden<br />
<strong>und</strong> höheren Nutzen erfahren als <strong>sozial</strong><br />
unterpivilegierte Zielgruppen. Des Weiteren<br />
bemerkt er, dass der Setting-<br />
Ansatz ursprünglich zur Gestaltung von<br />
Organisationsformen in „zweckrationalen<br />
Organisationen“, wie idealerweise<br />
Betriebe, Krankenhäuser sowie Verwaltungen<br />
konzipiert wurde <strong>und</strong> gegenwärtig<br />
durch die Zielstellung einer allgemeinen<br />
Lebensweltgestaltung in ungeeignetem<br />
Maße überdehnt wird. Laut<br />
Bauch (2002) sollte der Setting-Ansatz<br />
genutzt werden, um <strong>sozial</strong>e Strukturen<br />
in ges<strong>und</strong>heitsförderliche Gestaltungsmöglichkeiten<br />
einzubeziehen sowie<br />
ges<strong>und</strong>heitsförderliche Klimate zu etablieren.<br />
Als relevante Settings für die Zielgruppe<br />
<strong>sozial</strong> benachteiligter Jugendlicher<br />
werden Familie, Freizeit <strong>und</strong> Schule<br />
identifiziert (vgl. Ar<strong>bei</strong>tsgemeinschaft<br />
der Spitzenverbände der Krankenkassen<br />
2003; Forum Ges<strong>und</strong>heitsziele<br />
Deutschland 2003). Da<strong>bei</strong> wird die Erreichbarkeit<br />
über die Familie als weniger<br />
sinnvoll erachtet, da sich die definierte<br />
Zielgruppe an der Schnittstelle<br />
24<br />
zwischen Schul- <strong>und</strong> Ar<strong>bei</strong>tsleben befindet<br />
<strong>und</strong> der Familie nicht mehr allzuviel<br />
Bedeutung <strong>bei</strong>gemessen wird (vgl.<br />
Pinquart & Silbereisen 2002). Interventionen<br />
im familiären Kontext müssten<br />
bereits früher ansetzen. Auch der Zugang<br />
über den Freizeitbereich, wie z.B.<br />
über Sportvereine erscheint eher ungünstig,<br />
um <strong>sozial</strong> benachteiligte Jugendliche<br />
vollständig berücksichtigen<br />
zu können. Die Erreichbarkeit über das<br />
schulische Setting wird als besonders<br />
effektiv bewertet (vgl. Homfeldt & Barkholz<br />
1993), da die Institution Schule<br />
einen relevanten Teil der Lebenszusammenhänge<br />
von Heranwachsenden<br />
bestimmt (vgl. Leppin 1995) <strong>und</strong> die<br />
betrachteten Jugendlichen nach Verlassen<br />
der allgemeinbildenden Schule<br />
zumindest noch einer Teilschulpflicht<br />
an berufsbildenden Schulen unterliegen.<br />
Außerdem wird durch das Forum<br />
Ges<strong>und</strong>heitsziele Deutschland ausdrücklich<br />
darauf hingewiesen, dass<br />
besonders berufsbildende Schulen dazu<br />
<strong>bei</strong>tragen können „[…] die Querschnittsanforderung<br />
‚Ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Chancengleichheit’ umzusetzen, weil<br />
über dieses Setting mehr <strong>sozial</strong> benachteiligte<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
als in anderen Schulformen erreicht<br />
werden können“ (Forum Ges<strong>und</strong>heitsziele<br />
Deutschland 2003, S. 159). Beispielsweise<br />
werden berufsvorbereitende<br />
Bildungsgänge (BVJ, BGJ, BFS)<br />
speziell für <strong>sozial</strong> benachteiligte Jugendliche<br />
zur Ausbildungsvorbereitung<br />
angeboten (s. Kapitel 2).