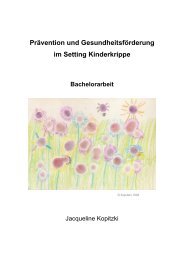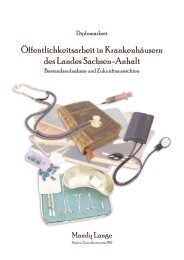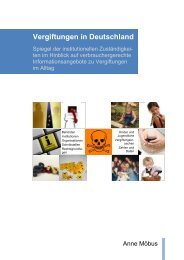Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7. Kapitel – Diskussion<br />
entwickeln können, in welchen sich<br />
Jugendliche tagtäglich aufhalten <strong>und</strong><br />
welche indirekt zu veränderten Verhaltensweisen<br />
<strong>bei</strong>tragen können (vgl. Ar<strong>bei</strong>tsgemeinschaft<br />
der Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen 2003; Langness et<br />
al. 2003; Rosenbrock 2004; SVR 2005;<br />
SVR 2000/01). Angesichts der beschriebenen<br />
Differenzen zwischen den<br />
Geschlechtern ist besonders <strong>bei</strong> Interventionen<br />
für Benachteiligte der Gender-Ansatz<br />
zu berücksichtigen (vgl.<br />
Höfer 2000, Kolip 2002). Beispielsweise<br />
könnten über berufsvorbereitende Bildungsgänge,<br />
welche an Berufsfachschulen<br />
angesiedelt sind vornehmlich<br />
weibliche Jugendliche sowie über die<br />
Berufsvorbereitung an Berufsschulen<br />
insbesondere männliche Jugendliche<br />
erreicht werden (vgl. BMBF 2005b).<br />
Außerdem sollten bewährte Erfahrungen<br />
aus der Ar<strong>bei</strong>t mit allgemeinbildenden<br />
Schulen in veränderter zielgruppenspezifischer<br />
Form auf die Berufsbildung<br />
übertragen werden. Ebenso sind<br />
<strong>bei</strong> der Projektplanung besondere Länderspezifitäten<br />
zu beachten, denn wie<br />
in den theoretischen Vorüberlegungen<br />
dargestellt wird, unterscheiden sich die<br />
16 B<strong>und</strong>esländer in Hinsicht zahlreicher<br />
Aspekte. Beispielsweise differieren die<br />
Anteile der Jugendlichen mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
(vgl. S. 19) in den alten<br />
B<strong>und</strong>esländern (Bremen <strong>und</strong> Hamburg:<br />
ca. 40%) im Vergleich zu den neuen<br />
B<strong>und</strong>esländern (Thüringen: 2,9%) beträchtlich<br />
(vgl. Block & Klemm 2005).<br />
Und da laut Klingholz (2005) die ethnische<br />
Herkunft eingebürgerter Migranten<br />
in keinster Weise mehr nachvollzogen<br />
werden kann, liegt der Anteil der Jugendlichen<br />
mit Migrationshintergr<strong>und</strong> –<br />
vornehmlich in den alten B<strong>und</strong>esländern<br />
– wahrscheinlich um das Doppelte<br />
höher (vgl. S. 15). Deshalb sind spezifi-<br />
59<br />
sche, die Ländereigenheiten berücksichtigende<br />
Konzepte erforderlich.<br />
Überdies sind <strong>bei</strong> der Projektplanung<br />
folgende Aspekte zu beachten:<br />
� Konzepte sollten langfristig angelegt<br />
sein sowie auf Verstetigung abzielen,<br />
denn kurzfristige Maßnahmen lassen<br />
sich nur unzureichend in den Alltag<br />
transferieren, erreichen keine dauerhaften<br />
Veränderungen <strong>und</strong> haben<br />
keinen nachhaltigen Charakter (vgl.<br />
Pott & Lehmann 2002).<br />
� Eine Einbeziehung der Zielgruppe<br />
bereits <strong>bei</strong> der Projektplanung ermöglicht<br />
eine hohe Akzeptanz der Maßnahme<br />
<strong>und</strong> regt Beteiligte zur aktiven<br />
Mitar<strong>bei</strong>t <strong>und</strong> Mitbestimmung an (vgl.<br />
Pinquart & Silbereisen 2004).<br />
� Zusammenhängende Probleme sollten<br />
gebündelt betrachtet werden,<br />
denn Einzelaktionen sind nicht nachhaltig<br />
<strong>und</strong> können daher keine Verhaltensänderungen<br />
bewirken (vgl.<br />
Langness et al. 2003).<br />
� Durch die Einbeziehung externer Akteure<br />
<strong>und</strong> Experten können sich regionale<br />
Kooperationen etablieren, welche<br />
einen Beitrag zur gesellschaftlichen<br />
Akzeptanz <strong>und</strong> eine besseren<br />
Implementierung derartiger Programme<br />
ermöglichen (vgl. Pinquart &<br />
Silbereisen 2004; Pott & Lehmann<br />
2002).<br />
� Die wissenschaftliche Evaluation der<br />
entwickelten Konzepte ist unerlässlich,<br />
zum einen um die Wirksamkeit<br />
zu prüfen <strong>und</strong> zum anderen um die<br />
Übertragbarkeit auf andere Strukturen<br />
<strong>und</strong> Rahmenbedingungen zu gewährleisten.<br />
� Durch die Vernetzung aller Beteiligten<br />
kann ein Erfahrungs- <strong>und</strong> Informationsaustausch<br />
initiiert werden (Pott &<br />
Lehmann 2002).