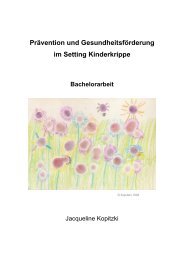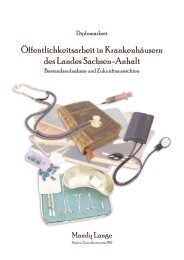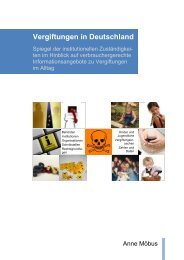Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Prävention und Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7. Kapitel – Diskussion<br />
2003), welches <strong>bei</strong> jedem Projekt parallel<br />
mitbear<strong>bei</strong>tet wird. Anhand dieser<br />
Tatsache wird jedoch deutlich, dass<br />
<strong>sozial</strong>e Benachteiligung im Bereich<br />
Schule nicht in Form eines Querschnittsthemas<br />
aufgegriffen werden<br />
kann. Bekanntlich sind in Schulen <strong>sozial</strong><br />
benachteiligte Zielgruppen nicht wie<br />
z.B. in Kindertagesstätten über den<br />
geographischen Zugang (Stadtteilbezug),<br />
sondern maßgeblich über bestimmte<br />
Schulformen wie <strong>bei</strong>spielsweise<br />
Förder- <strong>und</strong> Sonderschule, Hauptschule<br />
sowie berufsbildende Schule zu<br />
erreichen. Demnach können Interventionen,<br />
die <strong>bei</strong>spielsweise an Gymnasien<br />
ansetzen <strong>und</strong> die Querschnittsanforderung<br />
‚Soziale <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Chancengleichheit’ umsetzen nur einen<br />
geringen Beitrag zur Verringerung der<br />
Benachteiligung leisten. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong>e muss ähnlich der „Bauchtanzdebatte“<br />
15 Anfang der 90er Jahre (vgl.<br />
Meierjürgen 2002) eine Diskussion zum<br />
geeigneten Einsatz des Setting-<br />
Ansatzes bezüglich förderungswürdiger<br />
Schulformen erfolgen. Denn die Projektträger<br />
sollten sich ihres Auftrags im<br />
Klaren sein, welcher vordergründig die<br />
Bekämpfung <strong>sozial</strong>er Ungleichheiten<br />
<strong>bei</strong>nhaltet. Ges<strong>und</strong>heitsförderung zielt<br />
nicht darauf ab, Maßnahmen für besser<br />
gestellte Bevölkerungsgruppen durchzuführen,<br />
wie es bisher immer noch<br />
praktiziert wird, sondern gezielt <strong>sozial</strong>e<br />
Benachteiligungen zu verringern bzw.<br />
unterprivilegierten <strong>und</strong> hilfsbedürftigen<br />
Zielgruppen Perspektiven <strong>und</strong> Unterstützung<br />
aufzuzeigen.<br />
15 Als Folge der stärkeren wettbewerblichen Weichenstellung<br />
im System der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
gerieten die Ges<strong>und</strong>heitsförderungsaktivitäten<br />
der Krankenkassen zu Beginn der 90er Jahre zusehends<br />
in das Spannungsfeld zwischen ges<strong>und</strong>heitspolitischen<br />
<strong>und</strong> wettbewerblichen Zielen. Weil die oberen<br />
Bevölkerungsgruppen attraktive Mitglieder für die<br />
Krankenkassen darstellten, wurden diese mittels<br />
<strong>Prävention</strong>sprogrammen vornehmlich angesprochen<br />
(vgl. Meierjürgen 2002).<br />
58<br />
Potenzielle Projektträger sollten sich<br />
aufgr<strong>und</strong> der in der Berufsbildung vorherrschenden<br />
Rahmenbedingungen<br />
nicht von möglichen Interventionen abhalten<br />
lassen. Mittels der in berufsbildenden<br />
Schulen situierten differenzierten<br />
Bildungsgänge könnten ebenfalls<br />
Ressourcen entfaltet sowie Kooperationen<br />
geschaffen werden. Ebenso kann<br />
das Argument der unzulänglichen Erreichbarkeit<br />
von Schülern berufsbildender<br />
Schulen relativiert werden, da eine<br />
Vielzahl von Vollzeitbildungsgängen<br />
existieren. Beispielsweise sind die<br />
schulische Berufsvorbereitung <strong>und</strong><br />
auch zahlreiche Bildungsgänge der<br />
Berufsfachschulen in der Regel vollzeitschulisch<br />
angelegt (vgl. BMBF<br />
2005b).<br />
Bei der Planung <strong>und</strong> Durchführung<br />
von Interventionen für <strong>sozial</strong> benachteiligte<br />
Jugendliche ist vor allem darauf zu<br />
achten, dass insbesondere die Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Förderung <strong>sozial</strong>er <strong>und</strong> persönlicher<br />
Kompetenzen thematisiert<br />
wird (vgl. Langness et al. 2003). Projekte<br />
sollten nicht risiko-, sondern ressourcenorientiert<br />
angelegt sein <strong>und</strong> Kompetenzen<br />
fördern, Selbstwertgefühl <strong>und</strong><br />
Identität stärken sowie lebensorientierte<br />
Ansätze verfolgen. Niedrigschwellige<br />
Angebote, welche praktische bzw. erlebnispädagogische<br />
Elemente enthalten,<br />
können zur Akzeptanzsicherung<br />
bzw. erhöhten Motivation unterprivilegierter<br />
Zielgruppen <strong>bei</strong>tragen (vgl. Pott<br />
& Lehmann 2002). Ebenfalls sollten<br />
verstärkt gruppenpädagogische Ansätze<br />
genutzt werden. Des Weiteren konnte<br />
der Setting-Ansatz als geeignete<br />
Strategie zur Bekämpfung <strong>sozial</strong>er <strong>und</strong><br />
ges<strong>und</strong>heitlicher Ungleichheiten identifiziert<br />
werden, da sich durch die Einbeziehung<br />
verhältnispräventiver Elemente<br />
gesündere Lebenswelten (z.B. Schule)