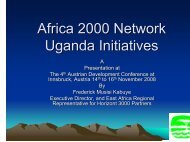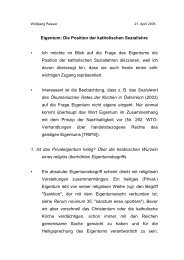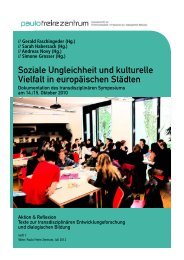DA Elisabeth Lambrecht.pdf
DA Elisabeth Lambrecht.pdf
DA Elisabeth Lambrecht.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
!)<br />
)<br />
8KQLRNJSTUM!:UJLVSVWUJM!OKX!(WYQTUQKQLRSM!<br />
) )<br />
Ein weiteres Missverständnis, das die Debatte um den Universalismus und Kulturrelativismus<br />
begleitet, erwächst aus der Formulierung „universell gültiger Prinzipien“, die<br />
von RelativistInnen abgelehnt werden. Denn mit diesen gehen zwei mögliche Bedeutungen<br />
einher. Die eine besteht in der Annahme, dass die Prinzipien universell akzeptiert<br />
und deswegen universell anwendbar seien. Die andere unterstellt, dass Prinzipien<br />
universell anwendbar sind, auch wenn sie nicht universell anerkannt sind (ebd.: 17). Es<br />
sei allerdings relevant, in diesem Punkt Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen zu vermeiden,<br />
so Cook. Es könne nämlich angenommen werden, dass der Relativismus leicht<br />
zu widerlegen sei, wenn nachgewiesen würde, dass ein moralisches Prinzip in allen<br />
Kulturen akzeptiert ist und damit eine kulturelle Universalie wäre. Es gebe gerade von<br />
Seiten einiger AnthropologInnen den Versuch, eine solche kulturelle Universalie mit<br />
dem Verweis auf beispielsweise das Inzestverbot zu bestimmen. KulturrelativistInnen<br />
würden sich allerdings durch ein solches Beispiel wenig beeindruckt zeigen. Sie würden<br />
nach wie vor auf den relativierenden Bezug verweisen und darauf aufmerksam machen,<br />
dass ein Prinzip, das in allen Kulturen als akzeptiert gelte, genauso relativ sei wie ein<br />
Prinzip, welches nur in einer Kultur verbindlich sei.<br />
Nach Cook verweise die universelle Akzeptanz zum einen nur auf die Mitglieder einer<br />
hier und jetzt bestehenden Kultur und zum anderen sei es absurd, anzunehmen, dass<br />
eine neu entstandene Kultur in dieser vorgestellten Welt, nur weil sie P nicht befolgt,<br />
automatisch moralisch minderwertig wäre (ebd.). An dieser Stelle würde der Kulturrelativismus<br />
erneut auf die enkulturelle Konditionierung verweisen mit der Normen und<br />
Werte vermittelt würden. Das mache moralische Prinzipien – auch wenn sie global auftreten<br />
sollte – kulturspezifisch (ebd.: 18 f.).<br />
Auch der Universalismus führt Argumente ins Spiel, die Cook erläutert, um Missverständnissen<br />
vorzubeugen. Grundlegend unterscheide der Universalismus zwischen zwei<br />
Aspekten, die oftmals vermischt würden. So gebe es einerseits moralische Vorstellungen,<br />
von denen einige Menschen glauben, dass sie moralisch absolut seien. Doch ein_e<br />
moralische_r AbsolutistIn würde den reinen Glauben einer Person nicht als eine Bestimmung<br />
für ein moralisches Diktum gelten lassen. Dafür bedürfe es zweier zu erfüllende<br />
beziehungsweise nachzuweisende Bedingungen. Erstens müsse das moralische<br />
Prinzip generell formuliert sein, so dass es im Falle seiner Wahrhaftigkeit auf alle anwendbar<br />
sei, auch wenn einige Personen es nicht akzeptierten. Zweitens müsse gezeigt<br />
werden, dass das Prinzip beziehungsweise seine Anwendung bekannt sei. Für ein wah-<br />
!<br />
%#!