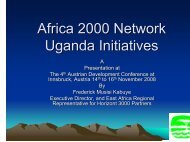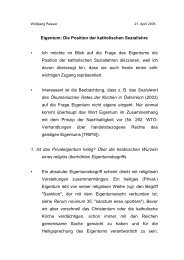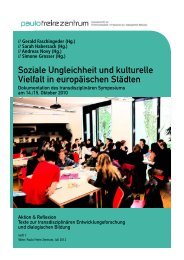DA Elisabeth Lambrecht.pdf
DA Elisabeth Lambrecht.pdf
DA Elisabeth Lambrecht.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 SCHLUSSFOLGERUNGEN<br />
Ausgangspunkt der vorliegenden Diplomarbeit war die Feststellung, dass in der bestehenden<br />
Literatur zur Kritik der Post-Development Theorien der spezifische Kulturbegriff<br />
eine Leerstelle in der Auseinandersetzung markiert. Zwar gibt es immer wieder<br />
vereinzelte Verweise auf einen impliziten Kulturrelativismus oder Momente der Romantisierung<br />
von traditionellen Kulturen, wie sie gerade für Gustavo Esteva nachgewiesen<br />
wurden, doch es liegt keine grundlegende Untersuchung des Kulturverständnisses<br />
vor. Das hat zur Folge, dass die enge Verknüpfung der Kritik der universalistischen<br />
Entwicklungsidee mit den politischen Forderungen nach einer neuen endogenen „Entwicklung“<br />
bisher noch zu wenig Berücksichtigung findet.<br />
Zur Untersuchung des spezifischen Kulturverständnisses wurden drei Autoren des Post-<br />
Development ausgewählt, die bedeutenden Einfluss auf die theoretische Ausgestaltung<br />
des Post-Development nahmen. Bei allen drei Autoren, Gustavo Esteva, Arturo Escobar<br />
und Wolfgang Sachs, ist eine Auseinandersetzung mit der Debatte um den Universalismus<br />
und den Kulturrelativismus gegeben. Die Debatte, die vornehmlich in der Disziplin<br />
der Philosophie angesiedelt, aber auch innerhalb der modernen Anthropologie wiederzufinden<br />
ist, erfährt durch das Post-Development Eingang in die Entwicklungstheorie.<br />
In einem dualistisch anmutenden Verständnis von Universalismus und Kulturrelativismus<br />
werden die Entwicklungsidee als Universalismus und Forderungen nach einer kulturell<br />
verankerten, neuen, endogen orientierten „Entwicklung“ als Kulturrelativismus<br />
gesehen. Letztere erweisen sich für die Autoren als wegweisendes Paradigma für die<br />
von ihnen geforderte Post-Development-Ära. Gustavo Esteva eruiert im Sinne des kulturrelativistischen<br />
Diktums unterschiedliche kulturelle Kollektive, welche ihre eigene<br />
Sprache und Kultur leben, die es auf andere nicht zu übertragen gilt. Entwicklung ist für<br />
ihn ein Begriff, der weder als Wort noch als kulturelle Praxis aus den diversen Kulturen<br />
der Entwicklungsländer stamme. Sie ist eine universelle Abstraktion, die es im Rahmen<br />
der Entwicklungspolitik ermöglichte, kulturell tradierte Konventionen über das Zusammenleben<br />
und dessen Organisierung „zu Tode (zu) entwickeln“ (Esteva 1992: 57). Darüber<br />
hinaus erschuf erst Entwicklung Phänomene der Unterentwicklung, so der Autor.<br />
Arturo Escobar begreift Entwicklung als Diskurs, der mit der Repräsentation der Dritten<br />
Welt Vorstellungen und Selbstwahrnehmung von entwickelten und unterentwickelten<br />
Subjekten festschrieb. Der im Westen verankerte Apparat von Wissen und Macht, der<br />
!<br />
91<br />
!