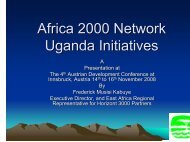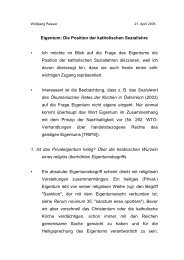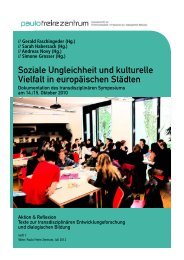DA Elisabeth Lambrecht.pdf
DA Elisabeth Lambrecht.pdf
DA Elisabeth Lambrecht.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
!)<br />
)<br />
7OLNOYYMLQNJZJS[OS!OKX!*KN\JT]LOKP!<br />
) )<br />
mag herauszufinden, wie verschiedene Wörter, die nicht die „eigenen“ sind, „uns einverleibt<br />
wurden“ (ebd.):<br />
„Wir müssen die Geschichte unserer Wörter schreiben; unter anderem um herauszufinden,<br />
ob die, die uns gelehrt werden, wirklich die unseren sind.“ (ebd.)<br />
In dem vom Poststrukturalismus inspirierten Verständnis von Sprache und ihrer Potenz,<br />
Wirklichkeit zu schaffen, identifiziert der Autor kulturelle Kollektive, welche jeweils<br />
eine eigene Sprache und Kultur hervorbringen, die es auf andere nicht zu übertragen<br />
gilt. Die Transformationen, welche die Länder des Südens erfuhren – ob nun durch koloniale<br />
Durchdringung oder durch Entwicklungsstrategien (das setzen AutorInnen des<br />
Post-Development oftmals gleich) – werden als exogen, von außen kommend, betrachtet.<br />
Dabei unterscheidet sich das Post-Development entschieden von dependenztheoretischen<br />
Strömungen. Das Post-Development macht zwar ebenfalls exogene Faktoren für<br />
die Unterentwicklung ausfindig, begreift aber die Übernahme von universalistischen<br />
Ideen und des Glaubens an Entwicklung als ursächlich für Unterentwicklung. Denn in<br />
den Gesellschaften des Südens – mit ihrem schon vom Kolonialismus und dann durch<br />
das Entwicklungsregime aufgezwungenen Korsett der Sprache – gehe die Transformation,<br />
Verdrängung und sogar der Verlust der jeweiligen Kultur einher. Die Verurteilung<br />
dieser äußeren Einwirkung basiert auf der Annahme, dass Länder oder unterschiedliche<br />
Gruppen von Menschen eine eigene Kultur besäßen. Nur diese besäße den Anspruch auf<br />
Gültigkeit und sei im Stande, die eigenen gesellschaftlichen Problemstellungen besser<br />
zu lösen als oktroyierte Konzepte wie das der Entwicklung. Hier präsentiert sich die<br />
schon angedeutete kulturrelativistische Orientierung Estevas auf einer wissenschaftstheoretischen<br />
Grundlage. Ganz offen schließt sich Esteva, wie das folgende Zitat zeigt,<br />
dieser Tradition des Denkens an:<br />
„Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts muß man, wenn man den kulturellen Relativismus<br />
voll akzeptiert – und nach Louis Dumont haben wir ihn zu akzeptieren –<br />
auch dessen Konsequenzen akzeptieren: die Auflösung der Werte.“ (Esteva 1992:<br />
22 f.)<br />
In der anschließenden Erklärung dieses Postulats führt Esteva an, dass der Kulturrelativismus<br />
nicht gleichbedeutend ist mit der Abkehr von Leitprinzipien und Regeln des<br />
Zusammenlebens, doch müssen diese die kulturell eigenen sein:<br />
„Das bedeutet natürlich nicht das Fehlen von Leitprinzipien für das Leben in Gemeinschaft.<br />
Es bedeutet genau das Gegenteil: Sie in der Wahrnehmung und den alltäglichen<br />
Verhaltensmustern fest verwurzelt zu haben, anstatt zu versuchen, sie<br />
!<br />
$(!