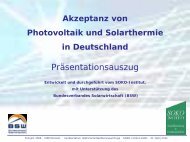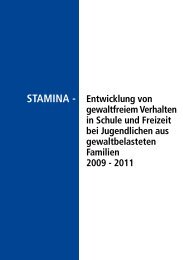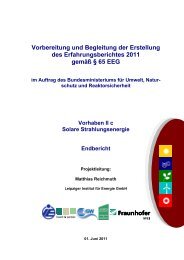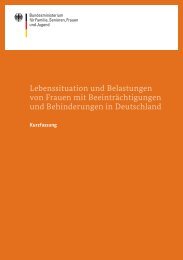Zwischenbericht 2010 zur Evaluation der ... - Bildungsketten
Zwischenbericht 2010 zur Evaluation der ... - Bildungsketten
Zwischenbericht 2010 zur Evaluation der ... - Bildungsketten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/3890<br />
dung und das Berufsleben. 6 In § 421s SGB III Satz 3 wird<br />
die Zielgruppe <strong>der</strong> Berufseinstiegsbegleitung wie folgt<br />
enger eingegrenzt:<br />
„För<strong>der</strong>ungsbedürftig sind Jugendliche, die voraussichtlich<br />
Schwierigkeiten haben, den Abschluss <strong>der</strong> allgemein<br />
bildenden Schule zu erreichen und den Übergang in eine<br />
berufliche Ausbildung zu bewältigen.“<br />
Diese allgemeine Charakterisierung <strong>der</strong> Maßnahmezielgruppe<br />
wird in <strong>der</strong> Geschäftsanweisung <strong>der</strong> BA (HEGA)<br />
vom 9. Dezember 2008 konkreter gefasst:<br />
„Zur Zielgruppe gehören leistungsschwächere Schüler,<br />
die einen Haupt- o<strong>der</strong> För<strong>der</strong>schulabschluss anstreben<br />
und voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, diesen<br />
zu erlangen. Bei diesem Personenkreis kann davon<br />
ausgegangen werden, dass auch die Integration in Ausbildung<br />
nach Beendigung <strong>der</strong> Schule mit Schwierigkeiten<br />
verbunden sein wird.“ (BA, 2008, S. 4)<br />
Die in <strong>der</strong> Geschäftsanweisung vorgenommene Präzisierung<br />
des Gesetzestextes begrenzt die Zielgruppe zunächst<br />
auf die Schülerinnen und Schüler allgemein bilden<strong>der</strong><br />
Schulen, die einen Haupt- o<strong>der</strong> einen För<strong>der</strong>schulabschluss<br />
anstreben. Damit werden zwei Gruppen von Jugendlichen<br />
angesprochen, die zwei ganz unterschiedliche<br />
Schulabschlüsse anstreben. Es ist zu vermuten, dass diese<br />
beiden Gruppen von Jugendlichen sowohl einen unterschiedlichen<br />
Betreuungsaufwand benötigen als auch in<br />
unterschiedlichem Maße die verschiedenen Ziele <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung<br />
erreichen werden. An dieser Stelle ist jedoch<br />
zunächst wichtig, dass diese zwei Teilgruppen von Schülerinnen<br />
und Schülern gleichermaßen an <strong>der</strong> Berufseinstiegsbegleitung<br />
teilnehmen können. 7<br />
6 Zur Abgrenzung <strong>der</strong> Zielgruppe <strong>der</strong> Jugendlichen mit schlechten<br />
Startchancen beziehungsweise mit För<strong>der</strong>bedarf siehe Walther/Pohl<br />
(2005) und Schwarz (2002).<br />
7 Eine Ausnahme stellt Sachsen dar. Dort sind nur Schülerinnen und<br />
Schüler in För<strong>der</strong>schulen in das Programm einbezogen.<br />
8 An <strong>der</strong> Stelle ist darauf hinzuweisen, dass in Deutschland <strong>zur</strong>zeit eine<br />
intensive bildungspolitische Debatte zum Thema Hauptschule geführt<br />
wird. Dabei gibt es Bundeslän<strong>der</strong>, in denen dieser Schultyp bereits<br />
aufgegeben wurde und an<strong>der</strong>e, die sich <strong>zur</strong>zeit in entsprechenden<br />
Umstrukturierungsprozessen befinden.<br />
Mit <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Geschäftsanweisung vorgenommenen<br />
Konkretisierung <strong>der</strong> Zielgruppe auf Jugendliche, die einen<br />
Haupt- beziehungsweise einen För<strong>der</strong>schulabschluss<br />
anstreben, werden weitere wichtige Abgrenzungen vorgenommen:<br />
Jugendliche, die einen Hauptschulabschluss anstreben,<br />
können diesen in sehr unterschiedlichen Schulformen<br />
ablegen. Bedingt durch die landeshoheitlich<br />
geregelten und damit unterschiedlichen Schulstrukturen<br />
im allgemein bildenden Schulsystem in Deutschland kann<br />
ein Hauptschulabschluss sowohl an Hauptschulen als<br />
auch an an<strong>der</strong>en Schulen abgelegt werden, die in ihrer<br />
Gesamtheit sowohl den Haupt- als auch an<strong>der</strong>e Schulabschlüsse<br />
wie zum Beispiel den Realschulabschluss anbieten.<br />
Zu dem letztgenannten Schultyp gehören zum Beispiel<br />
auch Gesamtschulen, Werkrealschulen o<strong>der</strong> auch<br />
an<strong>der</strong>e Schulformen. 8 Im Hinblick auf die Maßnahmebewertung<br />
ist daher zu berücksichtigen, dass bereits das rein<br />
schulische Umfeld <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Berufseinstiegsbegleitung<br />
teilnehmenden Jugendlichen sehr unterschiedlich ausgeprägt<br />
sein kann.<br />
Eine Beson<strong>der</strong>heit betrifft die Jugendlichen an den För<strong>der</strong>schulen,<br />
an denen die Berufseinstiegsbegleitung<br />
durchgeführt wird. Ausgehend von ihren praktischen Erfahrungen<br />
vertreten die pädagogischen Kräfte an diesen<br />
Schulen oft die Einstellung, dass ihre Schülerinnen und<br />
Schüler nach dem verpflichtenden Schulbesuch ohnehin<br />
erst einmal auf weiterführende Schulen wechseln. Aus<br />
dieser Perspektive stellt sich die Frage nach dem Sinn einer<br />
Berufseinstiegsbegleitung zu einem so frühen Zeitpunkt.<br />
Verstärkt wird diese Auffassung durch den Umstand,<br />
dass die Jugendlichen an diesen Schulen „nur“<br />
einen, dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Schulabschluss<br />
erreichen können, nicht jedoch den Hauptschulabschluss<br />
selbst. Daher wird zu prüfen sein, ob an diesen<br />
Schulen eine geringere Anzahl von Berufsorientierungsangeboten<br />
anzutreffen ist als an an<strong>der</strong>en für eine Maßnahmeteilnahme<br />
infrage kommenden Schultypen.<br />
2.4 Stand <strong>der</strong> bisherigen Literatur für<br />
Deutschland<br />
2.4.1 Kontextbeschreibung<br />
Die Übergänge sogenannter benachteiligter Jugendlicher<br />
von <strong>der</strong> Schule in den Beruf und die damit verbundenen<br />
Risiken des Scheiterns und <strong>der</strong> sozialen Ausgrenzung<br />
sind seit Ende <strong>der</strong> 1980er Jahre Gegenstand sozialwissenschaftlicher<br />
Untersuchungen. Von Beginn an bestand die<br />
Übergangsforschung dabei nicht nur aus grundlegenden<br />
Untersuchungen zum Strukturwandel <strong>der</strong> Jugendphase,<br />
son<strong>der</strong>n auch aus anwendungsorientierter Forschung im<br />
Kontext <strong>der</strong> zunehmend notwendigen Restrukturierung<br />
und Neukonzipierung von institutionellen Übergangsstrukturen<br />
und Übergangshilfen (zum Beispiel Brock<br />
et al. 1991).<br />
Der theoretische Kontext <strong>der</strong> Übergangsforschung ist dabei<br />
die Entstandardisierung des Lebenslaufs im Allgemeinen<br />
und <strong>der</strong> Jugendphase im Beson<strong>der</strong>en, in Folge <strong>der</strong>er<br />
Übergänge zwischen Jugend und Erwachsensein ungewisser<br />
und riskanter geworden sind (Stauber et al. 2007).<br />
Faktoren dieser Entwicklung sind auf <strong>der</strong> einen Seite die<br />
Entkoppelung von Bildung und Beschäftigung und die<br />
Flexibilisierung <strong>der</strong> Arbeitswelt. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite<br />
haben sich Lebensläufe und Muster <strong>der</strong> Lebensführung<br />
individualisiert und pluralisiert. Individuelle Entscheidungen<br />
haben gegenüber kollektiven Mustern <strong>der</strong><br />
Lebensführung an Bedeutung gewonnen, was jedoch keinesfalls<br />
dazu geführt hat, dass Strukturen sozialer Ungleichheit<br />
schwächer geworden sind.<br />
Untersuchungen wie das Übergangspanel des Deutschen<br />
Jugendinstituts (Gaupp et al. 2008) sowie die BiBB-<br />
Übergangsstudie (Beicht et al. 2008) zeigen, dass nicht<br />
nur Abgängerinnen und Abgänger von För<strong>der</strong>schulen,<br />
son<strong>der</strong>n inzwischen auch von Hauptschulen mehrheitlich<br />
nicht direkt nach <strong>der</strong> Schule in ein Ausbildungsverhältnis