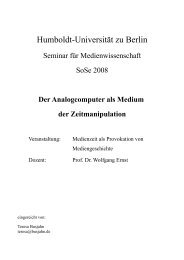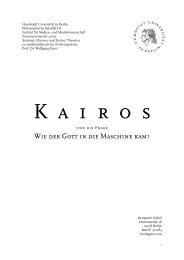Tradition1.pdf (Download) - Medienwissenschaft - HU Berlin
Tradition1.pdf (Download) - Medienwissenschaft - HU Berlin
Tradition1.pdf (Download) - Medienwissenschaft - HU Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Selbstermächtigung der Historiker<br />
Gadamer kommt auch auf jenen Mechanismus zu sprechen, der die<br />
alteuropäische Lese- und Schreibkultur von der Algorithmik des<br />
Computers trennt - wo "Texte" namens Programme tatsächlich,<br />
das tun, wofür sie stehen. Hier wird als Kommando der<br />
Verstehensbegriff plötzlich sehr unhermeneutisch:<br />
Nehmen wir das Beispiel des Verstehens eines Befehls. Einen Befehl gibt es nur dort, wo einer da ist, der ihn<br />
befolgen soll. Das Verstehen gehört hier also in ein Verhältnis von Personen, von denen die eine zu befehlen hat.<br />
Den Befehl verstehen heißt, ihn der konkreten Situation zu applizieren, in die er trifft. Zwar läßt man einen<br />
Befehl wiederholen, zur Kontrolle dessen, daß er richtig verstanden ist , aber das ändert nichts<br />
daran, daß sein wahrer Sinn sich erst aus der Konkretion seiner "sinngemäßen" Ausführung bestimmt. <br />
Sinngemäß heißt hier - ganz im Sinne des Deutschen Wörterbuchs<br />
der Gebrüder Grimm - noch ganz "Ausrichtung". Und doch bemißt<br />
sich Verstehen nicht in der schriftgemäßen Befolgung des<br />
Befehls allein: Gadamer klagt situative Kompetenz mit ein,<br />
also das, woran die Informatik mit sogenannten adaptiven<br />
Verfahren arbeitet. Gibt es den zeitverzogenen Befehl<br />
Denkt man sich nun einen Historiker, der in der Überlieferung einen solchen Befehl findet und verstehen will, so<br />
ist er zwar in einer ganz anderen Lage als der ursprüngliche Adressat. Er ist nicht der Gemeinte und kann daher<br />
den Befehl gar nicht auf sich beziehen wollen. Gleichwohl muß er, wenn er den Befehl wirkich verstehen will,<br />
idealiter die gleiche Leistung vollbringen, die der gemeinte Empfänger des Befehls vollbringt. Dem<br />
Selbstverständnis der Wissenschaft zufolge darf es also für den Historiker keinen Unterschied machen, ob ein<br />
Text eine bestimmte Adresse hatte oder als ein "Besitz für immer" gemeint war <br />
- womit wir fast schon in Weimar, nämlich in der Weimarer<br />
Klassik Goethes sind, und den Medien, die diesen ewigen Besitz<br />
instituieren: das Goethe- und Schillerarchiv. In der<br />
Unterscheidung einer konkreten Befehlsadressierung von<br />
allgemeingültiger Adressierung kommt Johann Gustav Droysens<br />
Differenz von intentionalem Denkmal und unwillkürlichem<br />
Überrest zum Zug.<br />
Die Selbstinterpretation der geisteswissenschaftlichen<br />
Methodik ist eine Selbstermächtigung, insofern "der Interpret<br />
zu jedem Text einen Adressaten hinzudenkt, ob derselbe durch<br />
den Text ausdrücklich angesprochen worden ist oder nicht"<br />
. Und doch sind Hermeneutik und<br />
Historik offenbar nicht ganz das gleiche; tatsächlich sucht<br />
der Historiker in überlieferten Texten ja garade nicht das<br />
Identische, sondern die Differenz seiner lesenden Gegenwart<br />
zur Vergangenheit: er strebt "durch dieselben hindurch ein<br />
Stück Vergangenheit zu erkennen", mithin also der<br />
perspektivische Blick Albertis, die fenestra aperta - wie es<br />
zeitgleich zum Buchdruck denkbar geworden ist.<br />
Er sucht daher den Text durch andere Überlieferung zu ergänzen und zu kontrollieren. Er<br />
empfindet es geradezu als die Schwäche des Philologen, daß dieser seinen Text wie ein Kunstwerk ansieht. Ein<br />
Kunstwerk ist eine ganze Welt, die sich in sich selbst genügt. Aber das historische Interesse kennt solche<br />
Selbstgenügsamkeit nicht. <br />
84