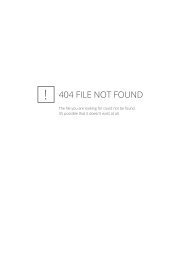Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
775 Jahre <strong>Berlin</strong> – Spuren des Mittelalters<br />
lichen Synagoge und des rituellen Tauchbades.<br />
In diesem Bereich wird derzeit gegraben – und<br />
zwar so tief, dass man auf die Treppe des Tauchbades<br />
stoßen könnte, die zum Grundwasser herabführte.<br />
Es wären die ersten Zeugnisse der mittelalterlichen<br />
jüdischen Gemeinde, die man auf<br />
<strong>Berlin</strong>er Gebiet finden würde. Die berühmten jüdischen<br />
Grabsteine aus dem 13. und 14. Jahrhundert<br />
stammen aus dem älteren Spandau, wo die<br />
<strong>Berlin</strong>er Juden ihre Toten bestatten ließen.<br />
Ganz in der Nähe, an der Ecke Stralauer Straße/Klosterstraße,<br />
wurde Mitte August ein überraschender<br />
Fund gemacht. Eine verbrannte<br />
Holzbohle, Eckpfosten eines Kellers unter einem<br />
Stall, ließ sich auf das Jahr um 1174 datieren. An<br />
der Cöllner Breiten Straße war bereits 1996 eine<br />
Bohle aus dem Jahr um 1171 geborgen worden.<br />
Damit ist bewiesen, dass Cölln und <strong>Berlin</strong> bereits<br />
um 1170 besiedelt waren – etwa 70 Jahre bevor<br />
die Städte in den ältesten erhaltenen Urkunden<br />
von 1237 und 1244 genannt werden. Dass auch<br />
die Besiedlung des Marienviertels wohl früher<br />
begann als bisher vermutet, ergaben die Ausgrabungen<br />
vor dem Roten Rathaus 2010. Schon<br />
um 1220, nicht erst um 1250, standen hier die ersten<br />
Häuser. Um 1280 wurde dann, am Schnittpunkt<br />
von Spandauer Straße und Oderberger<br />
Straße (heute Rathausstraße) mit dem Bau eines<br />
stattlichen Rathauses begonnen, das die aufstrebende<br />
Handelsstadt <strong>Berlin</strong> repräsentierte.<br />
Einen Vorgängerbau hat es sicher schon am Molkenmarkt<br />
gegeben. Das neue Rathaus – mit 39<br />
Metern Länge und 17 Metern Breite auch das<br />
größte profane Gebäude der Stadt – bildete ein<br />
Scharnier zwischen dem älteren Nikolaiviertel<br />
und dem jüngeren, größeren Marienviertel.<br />
Das mittelalterliche Rathaus war in jeder Hinsicht<br />
das Zentrum der Stadt. Hier tagte nicht nur<br />
der Rat, schworen Neubürger feierlich ihren Eid.<br />
Hier wurde auch Recht gesprochen und über die<br />
städtischen Ausgaben Buch geführt. Vom Rathaus<br />
wurden berittene Boten losgeschickt,<br />
wenn Überfälle drohten, um Hilfe aus verbündeten<br />
Städten zu holen. Auswärtige Weinhändler<br />
mussten sich hier melden, damit der Rat den<br />
Wein kostete und einen Preis festsetzte. Das<br />
Rathaus aber war auch Ort des Handels. Im untersten<br />
Geschoss standen zwischen den Pfeilern,<br />
die das Kreuzgewölbe trugen, die Tische der<br />
Händler, auf denen Wollstoffe aus Flandern, Leinen<br />
aus Westfalen und Samt aus Italien ausgebreitet<br />
waren. Der Dielenboden der 4,5 m hohen<br />
Kaufhalle lag eineinhalb Meter unter dem Straßenniveau.<br />
Die Archäologen legten die Außenwände<br />
und die Ansätze der gemauerten Pfeiler<br />
frei, die die lange Halle in vier Schiffe teilten. Im<br />
Boden fanden sich zahlreiche Dinge, die den<br />
Tuchhändlern durch die Finger gerutscht und in<br />
den Spalten der Dielen verschwunden waren:<br />
geschmiedete Nähnadeln, Stecknadeln, Fingerhüte<br />
aus Bronze, Plomben aus Blei, mit denen<br />
die Tuchballen verschlossen waren, außerdem<br />
zahlreiche Münzen. Etwa zwei Drittel der hier<br />
geborgenen mittelalterlichen Münzen stammen<br />
aus der Mark Brandenburg, der Rest vor allem<br />
aus Böhmen, Sachsen und Pommern. Im Bereich<br />
des Ratskellers wurden zudem kleine Würfel aus<br />
Knochen gefunden. Ab Herbst nächsten Jahres<br />
Abb. 3: »Spuren des Mittelalters«, Ausstellungsturm<br />
am Molkenmarkt, August 2012. Foto: Oana Popa<br />
Abb. 4: Der Große Jüdenhof 1933. Landesarchiv<br />
<strong>Berlin</strong>. Das Foto zeigt die Nordseite zur heutigen<br />
Grunerstraße hin. Das zweistöckige Haus ist das<br />
Haus Nr. 9, das vorspringende daneben Nr. 10.<br />
werden diese Funde erstmals in einer Sonderausstellung<br />
im Neuen Museum zu sehen sein.<br />
Schon jetzt kann man sich direkt an der Gertrauden-<br />
und Grunerstraße über die jüngsten Grabungsergebnisse<br />
und die zentralen Orte der mittelalterlichen<br />
Doppelstadt informieren. Acht<br />
pinkfarbene Ausstellungstürme – unübersehbar<br />
selbst für Autofahrer – helfen dabei, die Topografie<br />
der Stadt des 13. Jahrhunderts nachzuvollziehen<br />
und widerlegen gängige Vorurteile über<br />
diese vermeintlich finstere Epoche. Zudem weisen<br />
auf das Pflaster gesprühte Texte auf verschwundene<br />
Gebäude hin und erzählen vom Leben<br />
im mittelalterlichen <strong>Berlin</strong>.<br />
Annette Meier<br />
Die Autorin ist Redakteurin und Journalistin. Für die<br />
Ausstellung »Spuren des Mittelalters« hat sie die Bodentexte<br />
und zusammen mit Viola Goertz die Texte für die<br />
Ausstellungstürme verfasst.<br />
Jeden Donnerstag um 17 Uhr und jeden Sonntag um<br />
11 Uhr finden kostenlose Führungen zur Ausstellung<br />
statt, Treffpunkt ist der Infopoint vor der Marienkirche.<br />
Außerdem führen Archäologen auf der Grabungsfläche<br />
am Großen Jüdenhof.<br />
Informationen unter www.berlin.de/775/fuehrungen<br />
3 2 |<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2