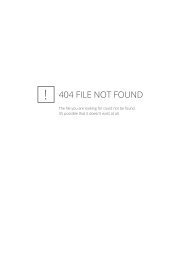Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Centrum Judaicum | Ausstellungen<br />
von links nach rechts:<br />
Gelber Schein, offiziell<br />
»Medizinisches Billet«,<br />
für Julia Mendik, St. Petersburg 1875.<br />
© Staatliches Historisches Archiv,<br />
St. Petersburg<br />
Innenseiten eines<br />
Gelben Scheins, 1894.<br />
© Staatliches Historisches Archiv,<br />
St. Petersburg<br />
Rosa Nelken mit zwei Männern,<br />
auf der Reise von Lemberg nach<br />
New York, um 1920. © UNOG Library,<br />
League of Nations Archive<br />
en, ihrem sozialen Hintergrund, ihren Motiven,<br />
Hoffnungen und Ängsten möglichst nahezukommen.<br />
Denn während die Aktivitäten diverser<br />
Komitees, die sich um 1900 zur »Bekämpfung<br />
des Mädchenhandels« bildeten, zumindest umfangreich<br />
dokumentiert sind, weiß man über<br />
die Lebensrealität ihrer Zielgruppe bis heute<br />
sehr wenig.<br />
Ein Dutzend Lebensschicksale, die für <strong>Berlin</strong><br />
und Bremerhaven jeweils unterschiedlich ausgewählt<br />
sind, stehen im Zentrum der Ausstellung.<br />
Da geht es zum Beispiel um die 18-jährige<br />
Dorothea Louise Ludwig, die 1864 aus Hessen als<br />
Tanzmädchen nach Kalifornien ging. Von den<br />
1000 Gulden »Kaufpreis«, der an ihre Eltern entrichtet<br />
wurde, bezahlten diese ihre Schulden.<br />
Oder um Sophia Chamys: Sie wurde ihrem Vater<br />
als 13-Jährige in Warschau »abgekauft«, um als<br />
Dienstmädchen nach Łódź zu gehen – wenige<br />
Monate später befand sie sich in einem Bordell<br />
in Buenos Aires. Fani Wajner und Liza Kowal<br />
schrieben 1906 einen erschütternden, im Original<br />
erhaltenen Brief aus Bombay: Aus Lemberg<br />
waren sie über Rio de Janeiro bis nach Indien verschleppt<br />
worden. Meta Stecher wiederum reiste<br />
als 14-Jährige aus Bremerhaven auf einem Passagierdampfer<br />
ganz allein nach New York. Anderthalb<br />
Jahre später wurde sie dort krank und völlig<br />
erschöpft aufgefunden: Mehrere Männer hatten<br />
sie vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen.<br />
Meist sind nur wenige Fragmente dieser Lebensgeschichten<br />
erhalten. Das Ausstellungsteam<br />
fand sie in Archiven unter anderem in <strong>Berlin</strong>,<br />
Buenos Aires, Genf, Odessa, Wien und St. Petersburg.<br />
»Der Gelbe Schein« – so der Titel der<br />
Ausstellung – steht für einen besonderen Aspekt<br />
der Lebensrealität dieser Mädchen und<br />
Frauen: Im vorrevolutionären Russland mussten<br />
Frauen, die der Prostitution nachgingen, einen<br />
solchen Ausweis beantragen oder bekamen ihn<br />
polizeilich aufgezwungen. Im Tausch dafür hatten<br />
sie ihre Personalpapiere abzugeben und verloren<br />
ihre bürgerliche Identität. Ein Rücktausch<br />
war fast unmöglich. Den Prostituierten wurden<br />
bestimmte Verhaltensmaßregeln und häufige<br />
medizinische Kontrollen auferlegt, jedoch eine<br />
gewisse Freiheit bei der Wahl ihres Wohnortes<br />
zugestanden. Für jüdische Frauen in Russland<br />
bildete dieser »Gelbe Schein« fast die einzige<br />
legale Möglichkeit, aus dem Ansiedlungsrayon<br />
für Juden in Großstädte wie Moskau oder St. Petersburg<br />
umzuziehen. Laut zeitgenössischen Berichten<br />
sollen Tausende jüdischer Frauen den<br />
»Gelben Schein« und ständige Gesundheitskontrollen<br />
auf sich genommen haben, ohne je<br />
als Prostituierte zu arbeiten. Das Sujet wurde<br />
vom jiddischen Theater um 1910 und in der Folge<br />
auch in verschiedenen internationalen Spielfilmen<br />
aufgegriffen. Nach aufwendigen Recherchen<br />
hat das Ausstellungsteam mehrere Exemplare<br />
des »Gelben Scheins« in einem Archiv in<br />
St. Petersburg gefunden; in der Ausstellung werden<br />
sie jetzt erstmals gezeigt.<br />
Nicht alle Lebensgeschichten, die in der<br />
Schau und dem zeitgleich erscheinenden Begleitband<br />
thematisiert werden, handeln von jüdischen<br />
Frauen, und nicht alle spielen in Russland.<br />
Gemeinsam aber ist allen, dass die Frauen<br />
der Armut und Ausweglosigkeit ihrer Lebenssituation<br />
nur entkommen konnten, indem sie<br />
neue Ausgrenzung auf sich nahmen. Sie mussten<br />
sich von ihrem vertrauten Umfeld, von den<br />
dort geltenden Werten und Moralvorstellung<br />
trennen und zogen oft um die halbe Welt. Manchen<br />
von ihnen gelang nach ein paar Jahren im<br />
Sexgewerbe der Ausstieg in ein ganz normales<br />
Familienleben. Manche wurden als Unternehmerinnen<br />
im Rotlichtmilieu reich. Doch die Umstände,<br />
unter denen ihre Lebenswege verliefen,<br />
sind bis heute so tabuisiert, dass es so gut wie<br />
keine mündliche oder private Überlieferung<br />
dazu gibt.<br />
So wirft die Ausstellung ganz bewusst mehr<br />
Fragen auf, als sie beantworten kann. Die von<br />
Andreas Heller Architects and Designers (Hamburg)<br />
gestaltete Schau lädt dazu ein, die großformatigen<br />
Porträts der Mädchen und Frauen<br />
auf sich wirken zu lassen, in Briefen, Polizeiprotokollen<br />
und alten Zeitungsartikeln zu lesen,<br />
Audiodokumente zu hören und in zehn Dossiers<br />
mehr über die Hintergründe des Mädchenhandels<br />
um 1900 zu erfahren. Eine filmische Installation<br />
des in <strong>Berlin</strong> lebenden, argentinischen<br />
Regisseurs und Filmemachers Ciro Cappellari<br />
stimmt mit Bildern aus dem heutigen Buenos<br />
Aires und Odessa auf die Beschäftigung mit einem<br />
vergessenen Aspekt der Zeitgeschichte<br />
ein – der überraschend aktuell wirkt.<br />
Irene Stratenwerth<br />
Irene Stratenwerth lebt als Journalistin, Autorin und<br />
Ausstellungskuratorin in Hamburg. Zuletzt erschien ihr<br />
Kriminalroman »Im wilden Osten dieser Stadt« (Rowohlt<br />
2012). Für die Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum<br />
realisierte sie seit 2001 mehrere große Ausstellungen,<br />
darunter »Wo ist Lemberg« im Jahr 2007.<br />
»Der Gelbe Schein. Mädchenhandel 1860 bis 1930«<br />
ist eine gemeinsame Ausstellung der Stiftung Neue<br />
Synagoge <strong>Berlin</strong> – Centrum Judaicum und des Deutschen<br />
Auswandererhauses Bremerhaven, ermöglicht durch die<br />
Kulturstiftung des Bundes. Es erscheint eine gleichnamige<br />
Publikation, hg. von Simone Eick und Hermann<br />
Simon, edition DAH, zum Preis von 14,80 €.<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2 | 6 3