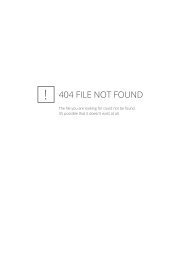Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abguss-Sammlung Antiker Plastik | Ausstellungen<br />
einen die großen europäischen Ausgrabungen,<br />
durch die zahlreiche originale Skulpturen in die<br />
Museen gelangten, und zum anderen der Verlust<br />
der Vorbildhaftigkeit der Antike für die zeitgenössische<br />
Kunst, worunter weniger die Aura des<br />
Originals als das Medium des Abgusses zu leiden<br />
hatte. All dies führte in der ersten Hälfte des<br />
20. Jahrhunderts zunächst zur Auslagerung von<br />
Gipsabgüssen aus den großen Museen, später<br />
dann sogar zur Zerstörung ganzer Sammlungen.<br />
Besonders im Zusammenhang mit dem sich<br />
schrittweise etablierenden Fach der Klassischen<br />
Archäologie waren Abguss-Sammlungen im<br />
deutschsprachigen Raum früh auch an den Universitäten<br />
entstanden. Zahlreiche universitäre<br />
Sammlungen führen bis heute diese Tradition<br />
fort. Seit den 1970er-Jahren werden ausgehend<br />
von diesen Lehrsammlungen die Abgüsse neu<br />
entdeckt: als Arbeitsmittel für Wissenschaft,<br />
Lehre und museale Didaktik. Wissenschaftliche<br />
Themen lassen sich mit Abgüssen leichter und<br />
kostengünstiger umsetzen, ungewöhnliche Projekte,<br />
wie etwa die Konfrontation von Antike<br />
und zeitgenössischer Kunst, können mit Abgüssen<br />
spielerisch durchgeführt werden. Das Medium<br />
Abguss bietet hier viele Möglichkeiten,<br />
und vor diesem Hintergrund zeichnet sich heute<br />
ein neuer Abguss-Boom ab.<br />
Die Abguss-Sammlung Antiker Plastik der<br />
Freien Universität <strong>Berlin</strong> zeigt in der Ausstellung<br />
zentrale Etappen aus der wechselhaften Geschichte<br />
der <strong>Berlin</strong>er Gipsabguss-Sammlungen.<br />
Höhen und Tiefen, Verehrung und Zerstörung<br />
dieses Mediums können hier besonders gut und<br />
exemplarisch aufgezeigt werden. Gleichzeitig<br />
will die Ausstellung auf die Möglichkeiten und<br />
Chancen hinweisen, die ein Arbeiten mit Abgüssen<br />
ermöglicht. Anhand historischer und<br />
neuer Abgüsse visualisiert die Ausstellung die<br />
großen Phasen der <strong>Berlin</strong>er Abguss-Sammlungen<br />
vom späten 17. Jahrhundert bis heute:<br />
Die Akademie: Im Rahmen der Gründung der<br />
Akademie der Künste 1696 durch den späteren<br />
Abguss eines hadrianischen<br />
Tondos vom<br />
Konstantinsbogen in<br />
Rom, Abguss: Antikensammlung<br />
SMB.<br />
Foto: Antonia Weiße<br />
König Friedrich I. in Preußen wurde die erste Abguss-Sammlung<br />
in <strong>Berlin</strong> eingerichtet. Sie umfasste<br />
bereits berühmte »opera nobilia« wie den<br />
Laokoon oder den Herakles Farnese.<br />
Das Neue Museum: Nach Übergabe der Sammlung<br />
an die Königlichen Museen zu <strong>Berlin</strong> waren<br />
die Abgüsse griechischer und römischer Skulpturen<br />
ab 1855 im Treppenhaus und im 1. OG des<br />
Neuen Museums zu sehen. Sie standen damit im<br />
Zentrum der <strong>Berlin</strong>er Museumslandschaft. Bald<br />
jedoch litten die Räume durch den rasanten Zugang<br />
neuer Stücke an einer Überfülle, die auch<br />
durch veränderte Aufstellungskonzepte nicht<br />
behoben werden konnte. Auch Abgüsse ägyptischer,<br />
vorderasiatischer und mittelalterlicher<br />
Skulpturen waren in den verschiedenen Abteilungen<br />
der Königlichen Museen zu sehen.<br />
Die Gipsformerei: Seit dem frühen 19. Jahrhundert<br />
etablierte sich als Teil der königlichen<br />
Museen die Gipsformerei, die im Laufe ihrer Geschichte<br />
einen Fundus von über 7000 Formen<br />
und Modellen zusammenstellen konnte.<br />
Die Universität: Geschmackswandel und<br />
Raummangel führten zu einer Verlagerung der<br />
Abgüsse aus dem Neuen Museum an die <strong>Berlin</strong>er<br />
Friedrich-Wilhelms-Universität. Ab 1921 waren<br />
die Gipse der griechisch-römischen Skulptur<br />
im Westflügel der Universität Unter den Linden<br />
großzügig ausgestellt und damit Bestandteil der<br />
akademischen Lehre im Fach der Klassischen<br />
Archäologie.<br />
Zerstörung – Wiederaufbau – Perspektive:<br />
Während und vor allem nach dem Krieg wurden<br />
unzähligeAbgüsse zerstört oder beschädigt.1977<br />
wurde in West-<strong>Berlin</strong> eine Kooperationsvereinbarung<br />
zwischen den Staatlichen Museen Preußischer<br />
Kulturbesitz und der Freien Universität<br />
<strong>Berlin</strong> zum Wiederaufbau der Abguss-Sammlung<br />
Antiker Plastik beschlossen. Seit 1988 ist die<br />
Sammlung als Museum öffentlich zugänglich<br />
und verfügt mittlerweile wieder über rund 2000<br />
Objekte. Ein Teil der alten <strong>Berlin</strong>er Sammlung ist<br />
heute unter anderem im Winckelmann-Institut<br />
der Humboldt-Universität zu sehen, der größte<br />
Teil liegt in einem Depot der Staatlichen Museen.<br />
Im Rahmen des Projektes »<strong>Berlin</strong>er Skulpturennetzwerk«<br />
konnten die Stücke in den letzten<br />
Jahren in einer Datenbank erschlossen und<br />
auf diese Weise zusammengeführt werden.<br />
Die Ausstellung wurde mit Studierenden der<br />
Klassischen Archäologie der Freien Universität<br />
erarbeitet und umgesetzt. Sie entstand in enger<br />
Kooperation von Freier Universität, Humboldt-<br />
Universität, Gipsformerei und Antikensammlung<br />
der Staatlichen Museen zu <strong>Berlin</strong>.<br />
Nele Schröder und<br />
Lorenz Winkler-Horaček<br />
Dr. Nele Schröder ist wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
am <strong>Berlin</strong>er Skulpturennetzwerk und am Institut für<br />
Klassische Archäologie der Freien Universität <strong>Berlin</strong>,<br />
PD Dr. Lorenz Winkler-Horaček ist Kustos der Abguss-<br />
Sammlung Antiker Plastik der Freien Universität <strong>Berlin</strong><br />
und lehrt dort am Institut für Klassische Archäologie.<br />
Der Begleitband zur Ausstellung erscheint im Verlag<br />
Marie Leidorf, Rahden/Westf., ca. 330 Seiten mit zahlreichen<br />
Abbildungen.<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2 | 5 5