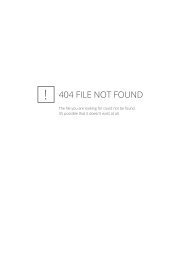Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausstellungen<br />
Schwules Museum<br />
Mädchen in Uniform<br />
Christa Winsloe (1888 –1944)<br />
30. November 2012 bis 4. März 2013<br />
»Mein Leben lang habe ich Tiere gezeichnet und<br />
modelliert und ein paar hübsche kleine Geschichten<br />
zusammengeschrieben. Jetzt wollte ich doch<br />
bloß mal versuchen, ob ich lebendige Menschen<br />
zustande bringe. Und da kommen nun auch noch<br />
all die Frauen, die keine Männer mögen und wollen<br />
mir einreden, ich hab dieses Stück für sie geschrieben.<br />
Ich fahr wieder heim nach München,<br />
da kenn ich mich besser aus.« So kokett reagierte<br />
Christa Winsloe im November 1931 nach der Premiere<br />
von »Mädchen in Uniform« im <strong>Berlin</strong>er<br />
Kino Capitol. Ihr zugrundeliegendes Theaterstück<br />
»Ritter Neréstan« wurde in Leipzig uraufgeführt<br />
und im folgenden Jahr unter dem Titel<br />
»Gestern und heute« an Bühnen in <strong>Berlin</strong>, Wien<br />
und Zürich inszeniert. Doch der durchschlagende<br />
Publikumserfolg kam erst mit der filmischen<br />
Bearbeitung. Das Drehbuch erstellte Christa<br />
Winsloe mit Leontine Sagan und Carl Froelich.<br />
Leontine Sagan, die das Stück bereits in <strong>Berlin</strong><br />
inszeniert hatte, führte unter der künstlerischen<br />
Oberleitung von Froelich Regie. Der Film galt<br />
als einer der besten des Jahres 1931, erzielte Preise<br />
und wurde weltweit gefeiert. Die zeitgenössische<br />
Filmkritik interpretierte den Film als Anklage<br />
gegen den preußischen Erziehungsdrill –<br />
Lotte H. Eisner, Herbert Ihering und Rudolf Arnheim<br />
ließen den lesbischen Subtext weitgehend<br />
unbeachtet. In der Lesbenzeitschrift »Die Freundin«<br />
wurde der Film euphorisch besprochen und<br />
eindeutig bewertet: »Die Lehrerin und die Schülerin<br />
lassen nicht mehr voneinander.« Der Film<br />
war sehr populär. So ging die Protagonistin Doris<br />
in Irmgard Keuns Roman »Das kunstseidene<br />
Mädchen«, der im Juni 1932 erschien, ins Kino:<br />
Sie sah »Mädchen in Uniform«. In diesem Jahr<br />
gab es in zahlreichen deutschen Städten erneut<br />
Inszenierungen des Theaterstücks.<br />
Christa Winsloe ist heute fast vergessen. Im<br />
AvivA-Verlag erscheint in diesem Herbst die<br />
erste Biografie »Meerkatzen, Meißel und das<br />
Mädchen Manuela« von Doris Hermanns. Neu<br />
aufgelegt wird auch der 1933 in Amsterdam erschienene<br />
Roman »Das Mädchen Manuela« bei<br />
Krug & Schadenberg. Das Schwule Museum<br />
nimmt dies zum Anlass, die Autorin und Bildhauerin<br />
Christa Winsloe in einer Ausstellung<br />
zu präsentieren.<br />
Christa Winsloe besuchte in Potsdam ein<br />
Mädcheninternat – Erlebnisse, die sie später literarisch<br />
verarbeitete. Sie zog zum Bildhauerstudium<br />
nach München und verkehrte in der<br />
Schwabinger Bohème. 1913 lernte sie den ungarischen<br />
Schriftsteller Lajos Hatvany kennen, den<br />
sie im gleichen Jahr heiratete. Zum Schreiben<br />
kam sie über die Bildhauerei. Eine Veröffentlichung<br />
in der renommierten Kulturzeitschrift<br />
»Querschnitt« erzählte von ihren Skulpturen:<br />
»Ich modelliere Tiere«. Neben ihrer bildhauerischen<br />
und journalistischen Arbeit verfasste sie<br />
Theaterstücke: Ihr erstes hieß »Ritter Nerestan«.<br />
1932 verliebte sie sich in die Journalistin<br />
und frühe NS-Kritikerin Dorothy Thompson. Sie<br />
gingen zusammen auf Reisen und Christa Winsloe<br />
zog zu ihr in die USA. Die Beziehung scheiterte<br />
nach zwei Jahren. Christa Winsloe tat sich<br />
mit ihrer weiteren Lebensplanung schwer. Sie<br />
reiste, lebte in München und in Frankreich. Ihre<br />
Bücher wurden nach 1933 in Deutschland nicht<br />
mehr verkauft. 1938 schrieb sie das Drehbuch für<br />
Unbekannter Fotograf, Christa Winsloe,<br />
ohne Jahr. Sammlung Renate von Gebhardt<br />
den Pabst-Film »Jeunes filles en détresse«. In<br />
den folgenden Jahren ließ sie sich in Cagnes,<br />
Südfrankreich, nieder und lebte dort mit der<br />
Schweizer Pianistin Simone de Gentet. Als die<br />
beiden aus Frankreich in ihre Herkunftsländer<br />
aufbrechen wollten, wurden sie 1944 in Cluny<br />
von Kriminellen erschossen. Lange hielt sich das<br />
Gerücht, sie seien als deutsche Spioninnen von<br />
der Résistance hingerichtet worden.<br />
8 8 |<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2