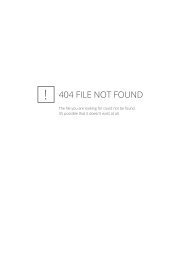Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Museum für Vor- und Frühgeschichte | Ausstellungen<br />
zur Verfügung. An prominenter Stelle und im<br />
Herzen der <strong>Berlin</strong>er Museumslandschaft erfährt<br />
dieses Projekt dadurch eine besondere Würdigung.<br />
Die dritte Ebene ist für die Ausstellung<br />
besonders geeignet. Die als Rundgang konzipierte<br />
Raumfolge ermöglicht eine chronologisch<br />
und thematisch stringent geführte Ausstellungskonzeption.<br />
Damit geht ein spannungsreicher<br />
Wechsel der Exponatgattungen einher,<br />
der die Aufmerksamkeit der Besucher stets aufs<br />
Neue weckt.<br />
Die Gliederung ist zugleich eine Einladung,<br />
über die wichtigsten Städte einen Zugang zur<br />
russischen Geschichte zu finden. Die Zeit bis um<br />
1800 ist in drei Abteilungen aufgeteilt: Nowgorod<br />
steht für die hoch- und spätmittelalterlichen<br />
Handelskontakte, Moskau für das aufstrebende<br />
Zarenreich, Petersburg für die Hinwendung<br />
Russlands zu Europa am Beginn des<br />
18. Jahrhunderts.<br />
Mit der Wahl der Städte ist auch ein Wechsel<br />
der Objektarten verbunden. Im Nowgoroder<br />
Raum dominieren archäologische Funde und<br />
das herausragende Gestühl der Rigafahrer aus<br />
der Stralsunder Nicolaikirche. Bei Moskau binden<br />
die Werke der Goldschmiedekunst die Aufmerksamkeit,<br />
die als diplomatische Geschenke<br />
in die Schatzkammern des Kreml gelangt sind.<br />
Der folgende große Saal ist St. Petersburg und<br />
den intensiven Verbindungen im 18. Jahrhundert<br />
gewidmet. Schwerpunkte bilden dabei in der<br />
Zeit Peters des Großen die Forschungsreisen<br />
und die Gründung der Akademie der Wissenschaften<br />
sowie die Gemälde aus den von Katharina<br />
der Großen erworbenen Kunstsammlungen,<br />
die den Grundstock der Sammlungen<br />
der Petersburger Eremitage bilden.<br />
Um wie vieles schwieriger ist es, die Beziehungen<br />
im 19. Jahrhundert darzustellen! Die Zahl<br />
und Vielfalt von Verbindungen und Exponaten<br />
nimmt dramatisch zu, eine lineare Erzählung erscheint<br />
nicht mehr möglich. Daher ist hier das<br />
Raumbild anders gewählt worden. Drei bankartige<br />
Einbauten gliedern längs den Raum. Ihnen<br />
sind Oberthemen zugeordnet: »Politik und<br />
Gesellschaft«, »Wirtschaft und Wissenschaft«,<br />
»Kunst und Kultur«.<br />
Die Besucher sind frei in der Wahl ihrer Zugänge,<br />
Durchlässe in den Bänken ermöglichen<br />
Fjodor S. Rokotow,<br />
Katharina im Zarenornat,<br />
1770, Öl auf<br />
Leinwand, 264 × 198 cm.<br />
Staatliches Historisches<br />
Museum Moskau.<br />
© bpk/Staatliches<br />
Historisches Museum<br />
Moskau. Foto: Alfredo<br />
Dagli Orti<br />
den Wechsel von einem Erzählstrang zum anderen<br />
und zeigen, wie verwoben die vielen Entwicklungslinien<br />
miteinander sind. Hier sei nur<br />
ein zunächst unscheinbares und kaum fingernagelgroßes<br />
Exponat genannt. Es ist der noch<br />
heute in <strong>Berlin</strong> im Naturkundemuseum bewahrte<br />
Diamant, den der russische Kaiser aus Dank<br />
für die Forschungen im Ural an Alexander von<br />
Humboldt sandte.<br />
Die Zäsur<br />
Wie ein Keil ragt eine schräg gestellte, spitze,<br />
metallisch beschlagene Wand in den Raum. Sie<br />
unterbricht die bisherigen Verbindungsstränge.<br />
Die Architektur deutet die große Zäsur in<br />
den deutsch-russischen Beziehungen an, die der<br />
Erste Weltkrieg und die Revolution bedeuten.<br />
Der im öffentlichen Bewusstsein viel präsentere<br />
Zweite Weltkrieg verdrängt häufig die Erinnerung<br />
an diesen folgenreichen Krieg und die folgende<br />
kurze Zwischenkriegszeit, in der keine<br />
stabilen Strukturen entstehen konnten. Der zunehmende<br />
Terror unter Stalin in Russland und<br />
die nationalsozialistische Machtübernahme in<br />
Deutschland führten direkt in die nächste Katastrophe.<br />
Der Hitler-Stalin Pakt und das geheime<br />
Zusatzprotokoll dokumentieren in der Ausstellung<br />
die Verbindung der beiden Diktatoren,<br />
bis mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion<br />
die schrecklichste Phase der Deutsch-Russischen<br />
Geschichte begann.<br />
Der Krieg<br />
Wie kann man sich diesen vier Jahren, in denen<br />
25–30 Millionen Einwohner der Sowjetunion und<br />
fünf Millionen Deutsche im Osten ums Leben<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2 | 5 7