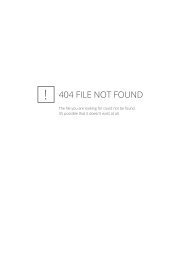Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutsches Historisches Museum | Ausstellungen<br />
»Les Constructeurs« eine heitere, sozialistische<br />
Utopie. Er konnte oder wollte nicht wissen, dass<br />
der Versuch, diese zu verwirklichen, in die Gulags<br />
führte.<br />
Anselm Kiefer und andere suchen historische<br />
Verdrängungen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit<br />
zu rücken. Der Blick in die Folterkammern<br />
zeigt, dass »Schrecken und Finsternis« real sind.<br />
Doch nicht nur in Diktaturen, auch in Demokratien<br />
herrschen Gewaltverhältnisse. Die Allgegenwart<br />
von Gewalt thematisiert etwa Sabina<br />
Shikhlinskaya. Auch Kinder können jederzeit<br />
Opfer von Gewalt werden, wie es Tadeusz Kantor<br />
zeigt. Den massiven Einschränkungen, denen<br />
sich die Menschen im Sozialismus ausgesetzt<br />
sahen, bringt Mladen Stilinović in seinem Wörterbuch<br />
zum Ausdruck. Es gibt keine Wörter<br />
mehr – nur noch das eine: »Schmerz«.<br />
Nach den eher abstrakten, gesellschaftlich<br />
relevanten Kategorien in den Kapiteln eins bis<br />
sechs gerät ab Kapitel sieben der Mensch immer<br />
mehr in den Blick: Wie denken die Künstler über<br />
den unaufhaltsamen Fortschritt, der unter dem<br />
Namen »Moderne« eine komplexe Struktur des<br />
Marktes, der Finanz- und Wirtschaftswelt hat<br />
entstehen lassen Andreas Gursky zeigt eine<br />
Welt, in der alles Konsum und jede Differenz nivelliert<br />
ist. Selbst die Natur scheint dem Diktat<br />
des Marktes unterworfen zu werden, womit die<br />
Frage aufkommt: Ist der Mensch Herr, Bewahrer<br />
oder Zerstörer der Schöpfung Im neunten Kapitel<br />
geht es um die Hülle bzw. um das Futteral<br />
der menschlichen Existenz. Dazu zeigt Donald<br />
Rodney in der Arbeit »Im Haus meines Vaters«<br />
die Zerbrechlichkeit des Lebens. Im zehnten Teil<br />
dann sehen die Künstler den Menschen schutzlos,<br />
wenn ihm die Alternativen verloren gehen:<br />
Sie denken sich in eine andere Welt, weshalb<br />
Lucio Fontana nach der Schreckenserfahrung<br />
des Zweiten Weltkriegs mit dem »Spazialismo«<br />
die Unendlichkeit des Universums erfahrbar<br />
machen wollte. Im elften Kapitel ist der Mensch<br />
mit sich selbst beschäftigt, aber auch mit seinen<br />
Ian Hamilton<br />
Finlay, Je vous<br />
salue Marat/<br />
Gegrüßet seist<br />
Du Marat, 1989.<br />
Neonröhren,<br />
Plexiglas,<br />
46 × 61 ×9cm.<br />
Mit freundlicher<br />
Genehmigung<br />
der Kewenig<br />
Galerie, Köln.<br />
© Estate of Ian<br />
Hamilton Finlay,<br />
Kewenig Galerie,<br />
Köln. Foto:<br />
Simon Vogel<br />
Grenzen. Francis Bacon wie andere Künstler setzen<br />
sich in einer kaum denkbaren Radikalität mit<br />
sich auseinander. Das zwölfte Kapitel schließlich<br />
widmet sich der künstlerischen »Welt im Kopf«.<br />
Hier stößt die Einbildungskraft des Künstlers,<br />
stoßen die Gegenwelten seiner »Kopfgeburten«<br />
abermals auf Vernunft, Utopie und Geschichte,<br />
Schrecken und Finsternis. Und wie viele Ideen<br />
haben etwa Joseph Beuys oder Erik Bulatov in<br />
die Welt gebracht<br />
Von der »Welt im Kopf« nehmen die Ideen<br />
ihren Lauf wieder hinaus in die Welt; eine Art<br />
Kreislauf entsteht. Die Themen der Künstler sind<br />
unabhängig von Zeit und Ort, kehren in sich verändernden<br />
Vorstellungen und Zusammenhängen<br />
immer wieder zurück und exponieren immer<br />
neu die Grundfragen unserer Existenz: Wie lebt<br />
der Mensch, wie organisiert, wie orientiert er<br />
sich Es geht um die Freiheit im gesellschaftlichen<br />
wie im individuellen Leben. Und darum,<br />
welche Verantwortung der Mensch teilt.<br />
Die »moderne« Kunst, da sind sich die meisten<br />
Kunsthistoriker einig, ist eine Folge der<br />
Aufklärung und war lange Zeit mit der Idee des<br />
Fortschritts verbunden. Von der Kunst stammt<br />
zumeist schon sehr früh der Einspruch der Vernunft,<br />
die ins Bild gesetzte Erkenntnis der Probleme.<br />
Goyas »Schlaf der Vernunft« ist die Ikone<br />
dieser Fragestellung geworden. Kunst hat Krisen<br />
thematisiert, Tabus gebrochen, Erstarrungen gelöst,<br />
Diskussionen erzeugt. Sie durchschneidet<br />
die Trennlinie zwischen den Generationen und<br />
Territorien, verbindet die Zukunft mit der Gegenwart.<br />
Kunst hat dazu beigetragen, Erkenntnisse<br />
über die Fehlentwicklungen der Moderne<br />
zu gewinnen und zugleich die Moderne durch<br />
ihre Kritik zu verteidigen. Und klärt uns die<br />
Kunst nicht über die gesellschaftlichen Deformationen<br />
auf<br />
Sie präsentiert nicht das richtige, sie erfindet<br />
ein mögliches Leben. Anders als die Historienbilder<br />
(die das richtige Leben zeigen wollen), decken<br />
die Werke in unserer Ausstellung die Probleme<br />
unserer Zeit auf. Sie machen die Idee der<br />
Freiheit nicht nur sichtbar, sondern befragen<br />
sie. Es könnte auch alles ganz anders sein (oder<br />
kommen), lautet die gar nicht so unterschwellige<br />
Devise. Bildende Kunst ist, anders als das<br />
Wort, eine universelle Sprache, die ohne Übersetzung<br />
überall (und überall anders) gedeutet<br />
werden kann. Sie lässt sich von keiner Mauer,<br />
von keinem Eisernen Vorhang davon abbringen,<br />
die Idee der demokratischen und künstlerischen<br />
Freiheit in ungeahnte Weiten zu tragen.<br />
Monika Flacke<br />
Prof. Dr. Monika Flacke ist Sammlungsleiterin am Deutschen<br />
Historischen Museum und Gesamtleiterin der<br />
Ausstellung. Sie hat die Ausstellung zusammen mit<br />
Henry Meyric Hughes und Ulrike Schmiegelt kuratiert.<br />
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, in dem ca. 250<br />
Kunstwerke ausführlich beschrieben werden. Der <strong>Berlin</strong>er<br />
Kunst- und Bildhistoriker Horst Bredekamp hat die<br />
zwölf Kapitel in einer vorangestellten Übersicht<br />
zusammengefasst. Der Katalog bedeutet in seiner Art<br />
ein Novum: Er erscheint sowohl in einer ausführlichen<br />
elektronischen als auch in einem knapperen Printformat.<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2 | 7 7