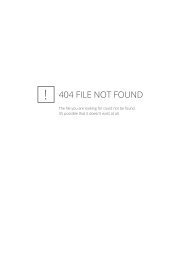Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausstellungen<br />
Aktives Museum in der Akademie der Künste am Pariser Platz<br />
Letzte Zuflucht Mexiko<br />
Gilberto Bosques und das deutschsprachige Exil nach 1939<br />
3. Dezember 2012 bis 14. April 2013<br />
»Fremdes Land, wo nichts mir angehört,<br />
Weder Haus noch Baum noch Vogelnest.<br />
Land, dem ich wie Strangut angeschwemmt.<br />
[…]<br />
Für das Land, das wahllos mich verstieß,<br />
Tausche ich Dich ein, Du Paradies.«1<br />
Diese Zeilen stammen aus einen Gedicht von<br />
Paul Mayer mit dem Titel »Dank an Mexico«, das<br />
1943 in der New Yorker Emigrantenzeitschrift<br />
»Aufbau« veröffentlicht wurde. Der Autor und<br />
Verleger Paul Mayer (1889–1970) gehörte zu den<br />
etwa Tausend deutschsprachigen Emigranten,<br />
die zwischen 1933 und 1945 in Mexiko Zuflucht<br />
fanden. Das Aktive Museum bereitet in Kooperation<br />
mit der Akademie der Künste <strong>Berlin</strong>, dem Iberoamerikanischen<br />
Institut <strong>Berlin</strong> und dem Instituto<br />
deInvestigaciones Interculturales Germano-<br />
Mexicanas eine Ausstellung vor, die sich exemplarisch<br />
mit der Geschichte von <strong>Berlin</strong>er Emigrantinnen<br />
und Emigranten in Mexiko befasst.<br />
Ähnlich wie Varian Fry, dessen Arbeit als<br />
Fluchthelfer Tausender Emigranten eine Ausstellung<br />
des Aktiven Museums 2006 ebenfalls<br />
in der Akademie der Künste dokumentierte, hat<br />
der mexikanische Generalkonsul jener Jahre,<br />
Gilberto Bosques, ab 1939 zunächst in Paris und<br />
dann von 1940 bis 1942 in Marseille durch die<br />
Erteilung von Visa vielen deutschen und österreichischen<br />
Emigranten noch in letzter Sekunde<br />
das Leben gerettet. Unter ihnen waren zahlreiche<br />
Mitglieder der Akademie der Künste sowie<br />
Künstler und Schriftsteller, deren Nachlässe im<br />
dortigen Archiv bewahrt werden. Zu ihnen gehören<br />
unter anderem Hanns Eisler, Egon Erwin<br />
Kisch, Rudolf Leonhard, Anna Seghers, Steffie<br />
Spira und Paul Westheim.<br />
»Dieses Mexiko hat<br />
einfach die Tür aufgemacht …«2<br />
MexikosAußenpolitik in den1930er-Jahren zeichnete<br />
sich durch eine konsequent antinazistische<br />
Haltung aus: So verweigerte das Land 1938 dem<br />
»Anschluss« Österreichs die Anerkennung und<br />
protestierte 1939 vor dem Völkerbund gegen<br />
die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Im Juni<br />
1938 erklärte der mexikanische Präsident Lázaro<br />
Cárdenas die Bereitschaft seines Landes, den<br />
politischen Flüchtlingen vor der nationalsozialistischen<br />
Verfolgung in Europa die Tore zu öffnen.<br />
Waren es zunächst insbesondere die rund<br />
15 000 republikanischen Spanienkämpfer, denen<br />
die Regierung Mexikos zur Befreiung aus der Internierung<br />
in Frankreich und zur Ausreise aus<br />
Europa verhalf, so kamen bald auch zahlreiche<br />
deutschsprachige Emigranten hinzu, die noch<br />
in der Region Marseille festsaßen. Viele von ihnen<br />
hatten in den Internationalen Brigaden der<br />
Spanischen Republik gekämpft und waren nach<br />
deren Niederschlagung ebenfalls in Frankreich<br />
interniert worden. Aufgrund einer ersten Liste<br />
wies Präsident Cárdenas am 9. September 1940<br />
den mexikanischen Generalkonsul Gilberto Bosques<br />
in Marseille an, für zwanzig prominente<br />
deutsche politische Flüchtlinge und ihre Familienangehörigen<br />
Visa zu erteilen. Zu dieser ersten<br />
Gruppe gehörten neben Anna Seghers unter anderem<br />
die Schriftsteller Franz Werfel, Alfred Döblin,<br />
Walter Mehring und Emil Julius Gumpel sowie<br />
die Mutter von Hermann Kesten. Nicht alle<br />
Genannten gingen dann auch nach Mexiko, aber<br />
das Visum ermöglichte ihnen angesichts des<br />
Vormarsches der deutschen Wehrmacht und der<br />
drohenden Besetzung des zunächst noch freien<br />
Süden Frankreichs die Ausreise. Mexiko wurde<br />
so zu einem der letzten Auswege aus Europa.<br />
Von 1940 bis 1942 wurde Gilberto Bosques<br />
Teil eines Netzwerkes von Hilfsorganisationen<br />
in Marseille. Zur Unterbringung der Flüchtlinge<br />
mietete er zwei Schlösser in Reynarde und<br />
Montgrand, sorgte für Lebensmittel, medizinische<br />
Versorgung und juristische Beratung und<br />
organisierte eine Arbeitsvermittlung bis zur<br />
Ausreise. Nach der deutschen Besetzung Südfrankreichs<br />
und der Schließung des Konsulats<br />
Ende 1942 wurde Gilberto Bosques selbst nach<br />
Deutschland deportiert und über ein Jahr im<br />
»Rheinhotel Dreesen« in Bad Godesberg interniert.<br />
Bei seiner Rückkehr nach Mexiko bereiteten<br />
ihm die noch dort lebenden deutschen Emigranten<br />
einen begeisterten Empfang.<br />
»Dies ist ein Land, in dem<br />
ein Kunstmensch leben kann.«3<br />
Es waren vor allem die politisch Verfolgten unterschiedlichster<br />
Gruppierungen, unter ihnen<br />
viele Schriftsteller und Künstler, die in Mexiko<br />
eine neue politische Heimat suchten. Anders<br />
als in den meisten Exilländern war es in Mexiko<br />
nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht,<br />
dass sich die aufgenommenen Flüchtlinge poli-<br />
6 4 |<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2