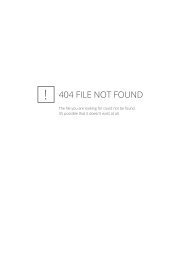Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutsches Historisches Museum | Aus den Sammlungen<br />
(540–604) kniet um 600 in der Kirche Santa Croce<br />
in Rom, als ihm der gekreuzigte Jesus über<br />
dem Altar erscheint. Alle Marterwerkzeuge, die<br />
ihn ans Kreuz brachten, werden aufgezählt. Sie<br />
dokumentieren akribisch seinen Opfergang. Die<br />
Botschaft ist eindeutig: Er ist für uns gestorben,<br />
mehr noch, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen,<br />
um uns von unserer Schuld zu erlösen. Und<br />
als Beweis fließt sein Blut in den Kelch des Papstes.<br />
Daran erinnert die Holztafel mit der Gregorsmesse<br />
aus dem Jahr 1496 und verkündet in<br />
einem Textteil: »Wer in Reue und Andacht fünf<br />
Vaterunser spricht, der erwirbt dreizehntausendfünfzehn<br />
Jahre Ablass und muss sich nicht sorgen.«<br />
Gemeint sind damit also nicht nur der Betende<br />
und seine lange Zeit in der Vorhölle bis zum Ende<br />
der Welt, sondern auch alle Vorfahren, die nicht<br />
um Ablass beten konnten. Eigentlich eine tolle<br />
Erfindung. Musste man früher persönlich nach<br />
Rom reisen, um den Ablass zu erwirken, trat nun<br />
ein Kniefall mit Gebet vor diesen mobilen Bildern<br />
an die Stelle der weiten Romreise. Man<br />
konnte zu Hause bleiben und seiner Arbeit nachgehen.<br />
Wurde einem das Beten zu lang, konnte<br />
auch eine Geldspende für den Bau von Sankt Peter<br />
in Rom Gleiches bewirken. Aber dies bot<br />
Sprengstoff: Diese finanziellen Transferleistungen<br />
aus dem Deutschen Reich in Richtung Italien<br />
und Mittelmeer wurden um 1500 den Landesfürsten<br />
nördlich der Alpen zuviel. Sie wollten<br />
den Ablasshandel einschränken. Luther kam ihnen<br />
gerade recht, der nun den nächstbesten Verkäufer<br />
von Ablassbriefen im Raume Wittenberg<br />
für alle Zeit an den protestantischen Pranger<br />
stellte: Es handelte sich um den Dominikanermönch<br />
Johann Tetzel (um 1460–1519), der seinen<br />
von links nach rechts:<br />
Philipp Fleischer, Schichtwechsel<br />
beim Bau des Gotthard-Tunnels,<br />
1886. Öl auf<br />
Leinwand, 250 × 488 cm.<br />
Deutsches Historisches<br />
Museum<br />
Amtspflichten nachging. Richtig berühmt wurde<br />
Tetzel nicht im 16., sondern erst im 19. Jahrhundert.<br />
Auf den Historiengemälden, die den<br />
Protestantismus in ihrer Zeit feierten, wird der<br />
Dominikaner als ein feister, fetter Nichtsnutz<br />
dargestellt, der die Gläubigen narrt und ihnen<br />
das Geld aus der Tasche zieht.<br />
Dass Bildnisse in ihrer Zeit ein Affront sein<br />
konnten, sieht man ihnen heute teils nicht mehr<br />
an. Das Ehebildnis von Martin Luther (1483–<br />
1546) und seiner Frau Katharina von Bora (1499–<br />
1552) schreckt die meisten von uns heute nicht<br />
mehr. Aber als strenggläubiger Katholik, und<br />
es gab in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts<br />
kaum Andersgläubige, sah man in diesem Ehebildnis<br />
den Augustinermönch, der eine aus dem<br />
Kloster entflohene Nonne geheiratet hat – ein<br />
Skandalbild aus der Werkstatt der Cranachs. Es<br />
machte den Gemeinden der Protestanten so viel<br />
Freude, dass es vermutlich hundertmal nachbestellt<br />
worden ist und folglich heute in fast jeder<br />
größeren Gemäldegalerie hängt. Das »Porträt<br />
des toten Luther« ist schon seltener. Aber<br />
auch dieses Werk aus dem Atelier der Geschichte<br />
war in seiner Zeit der Beweis dafür, dass er<br />
nicht vom Teufel geholt worden ist. Ein bildhafter<br />
Beleg für Gegner in Rom, die Luther als vom<br />
Teufel besessen gebrandmarkt und prophezeit<br />
Thoman Burgkmair,<br />
Gregorsmesse, 1496.<br />
Öl auf Holz, 143,5 × 133 cm.<br />
Deutsches Historisches<br />
Museum<br />
Francois Gérard,<br />
Napoleon I., Kaiser der<br />
Franzosen (1804–14/15), im<br />
Krönungsornat, 1806–10. Öl<br />
auf Leinwand, 223 × 146 cm.<br />
Deutsches Historisches<br />
Museum<br />
Alle Abbildungen:<br />
© Deutsches Historisches<br />
Museum. Foto: Arne Psille<br />
hatte, dass in seiner Todesstunde der Teufel aus<br />
ihm fahren würde.<br />
Die Ausstellung »Im Atelier der Geschichte«<br />
widmet sich hundert solcher Erzählungen aus<br />
500 Jahren. Sie will ein wenig belehren, viel unterhalten,<br />
von der Arbeit aus der Sammlung der<br />
letzten 25 Jahre erzählen und die Besucher ins<br />
Atelier der Geschichte des DHM locken.<br />
Dieter Vorsteher-Seiler<br />
Dr. Dieter Vorsteher-Seiler ist Abteilungsleiter Sammlungen<br />
und Stellvertreter des Präsidenten. Er hat die<br />
Ausstellung »Im Atelier der Geschichte« mit Dr. Sabine<br />
Beneke und Dr. Brigitte Reineke kuratiert.<br />
Anlässlich der Ausstellung erscheint die Publikation:<br />
Im Atelier der Geschichte. Aus der Gemäldesammlung<br />
des Deutschen Historischen Museums mit ca. 320 Seiten<br />
zum Museumspreis von 25 €.<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2 | 4 1