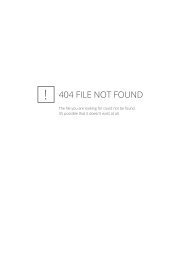Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Ansichtsexemplar (KPB_MJ2014) - Kulturprojekte Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stadtmuseum <strong>Berlin</strong> – Ephraim-Palais | Ausstellungen<br />
gen, Duktus und Form wirken gestischer. Damit<br />
geht eine verstärkte Verarbeitung christlicher<br />
und mythologischer Themen einher. Ist es Blasphemie,<br />
die badende Batseba aus ihrem alttestamentarischen<br />
Zusammenhang zu reißen oder<br />
beim »Einzug nach Jerusalem« eine Frau den Esel<br />
reiten zu lassen Grützkes Denkweise ist eine<br />
andere. Wenn bei ihm Jesus eine nackte Frau ist,<br />
so deshalb, weil das Bild nicht dadurch authentischer<br />
würde, wenn er ein Modell nähme, das<br />
Albrecht Dürer ähnlich sähe.<br />
Die wichtigste mythologische Gestalt ist für<br />
Grützke Prometheus, der Sage nach Schöpfer<br />
Johannes Grützke,<br />
Prometheus, 1980.<br />
Pastell, 180 × 100 cm.<br />
Ladengalerie <strong>Berlin</strong>.<br />
© VG Bild-Kunst,<br />
Bonn 2012.<br />
Foto: Marie Walter<br />
Johannes Grützke,<br />
Darstellung der Freiheit,<br />
1972. Öl auf Leinwand,<br />
170 × 200 cm. Privatbesitz.<br />
© VG Bild-Kunst,<br />
Bonn 2012. Foto:<br />
Bildarchiv Foto Marburg<br />
Da tritt er als dreifacher Riese auf, spielt mit seinem<br />
Alter Ego auf einer Wiese Mikado, balanciert<br />
einen Muskelkopf, drückt einen Säugling<br />
an sich oder stemmt zusammen mit einer – seiner<br />
– Frau ein Tablett in die Höhe; er mit weiblicher<br />
Brust, sie mit männlicher Armmuskulatur.<br />
Die Erwartungshaltung wird auf eine harte Probe<br />
gestellt, insbesondere die gewählte Draufsicht,<br />
eine sich nach unten hin verjüngende Perspektive<br />
und widernatürliche Körpertorsionen<br />
konterkarieren gängige Sehgewohnheiten.<br />
Grützke spiegelt sich, selbst wenn im Spiegel<br />
andere erscheinen. Die Darstellung des Menschen,<br />
anfangs ausschließlich von Männern,<br />
wurde Ende der 1960er-Jahre zum Thema großformatiger<br />
Kompositionen. Der Kontrast zwischen<br />
seriöser Aufmachung und kindischem<br />
Verhalten, zwischen detailgetreuer Abbildhaftigkeit<br />
und verrätselter Raumsituation, birgt bei<br />
nicht geringem Unterhaltungswert ein Element<br />
tiefer Irritation.<br />
1972 betritt mit der »Darstellung der Freiheit«<br />
die erste weibliche Nackte eine Leinwand Grützkes.<br />
Seine »Freiheit« ist eine sexuell emanzipierte,<br />
selbstbestimmte Frau. Aber die Botschaft<br />
des Künstlers erschöpft sich nicht in der Hinterfragung<br />
stereotyper Geschlechterrollen. Grützke<br />
führt quasi ein Stück auf, ein Lehrstück, das<br />
von einem Befreiungsakt in allgemeinem Sinn<br />
handelt: »Wenn ich die Menschheit male, nehme<br />
ich gewöhnlich eine nackte Frau.« Was im Umkehrschluss<br />
heißt: Eine unbekleidete weibliche<br />
Figur ist nicht das, was sie vordergründig vorgibt<br />
zu sein, sondern steht für eine übergeordnete<br />
Aussage. Dem Zugriff auf den Fundus ikonografischer<br />
Muster – hier Eugène Delacroix’<br />
»La Liberté guidant le peuple« – entspricht die<br />
akademische Methode von Modell-Arrangement<br />
und gründlichem Vorstudium.<br />
Als Schüler der »Neuen Prächtigkeit« greift<br />
Grützke die im 19. Jahrhundert beliebte Gattung<br />
des Historien- bzw. Ereignisbildes auf, freilich<br />
unter überraschender Wendung des geschilderten<br />
Geschehens. Bei ihm wird Benno Ohnesorg<br />
nicht erschossen, vielmehr greift dieser ein Jahr<br />
nach seinem Tod zum Gewehr. Das eigentlich<br />
leicht erkenn- und benennbare Bildgeschehen<br />
entzieht sich einfacher Deutung, zumal Grützke<br />
in den 1970er-Jahren begann, seine bevorzugten<br />
Sujets um narrative Elemente zu bereichern und<br />
alltägliches Tun durch Rückgriff auf hergebrachte<br />
Bildtypologien zu adeln.<br />
Mit den 1980er-Jahren wandelte sich Grützkes<br />
Stil. Die Malschicht wird pastoser aufgetra-<br />
der Menschheit, mit dem er sich als Erzeuger<br />
von Kunst und Leben identifiziert. Wenn Prometheus<br />
seine Entwürfe zerstört, für die Menschheit<br />
das Feuer stiehlt und von Zeus zur Strafe<br />
angekettet wird, so geht es auch immer um persönliche<br />
Ängste und Wünsche des Künstlers. In<br />
solchen Momenten schlüpft Grützke gar nicht<br />
in eine Rolle – »nein, ich bin es wirklich«.<br />
Dominik Bartmann<br />
Prof. Dr. Dominik Bartmann ist Ausstellungsdirektor des<br />
Stadtmuseums <strong>Berlin</strong>.<br />
Zur Ausstellung erscheint eine Broschüre, die an der<br />
Museumskasse für 2 € erhältlich ist.<br />
M U S E U M S J O U R N A L 4 / 2 0 1 2 | 7 9