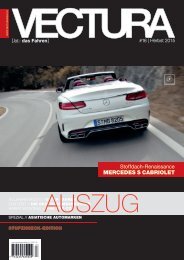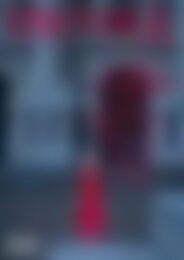_PRESTIGE_Mallorca_2_2015
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CULTURE<br />
der Grossen Pest verändert sich zudem die Einstellung zu irdischen Dingen,<br />
denn es kommt das Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit auf (Vanitas-<br />
Motive: brennende Kerzen, Sanduhren), wie dies beispielsweise schön im<br />
Kupferstich «Melancolia I» von 1514 von Albrecht Dürer zum Ausdruck kommt.<br />
Es ist die Geburt der Welt der Dinge. Anfänglich sammelt man Kurioses sowie<br />
Interessantes und stellt es in sogenannten Kuriositätenkabinetten, einer Art<br />
Möbelstück, die sich beispielsweise in Apotheken (mit getrockneten Fischen,<br />
Teilen von ägyptischen Mumien) finden liessen, aus.<br />
Daraus entwickelten sich wiederum die Wunderkammern oder Kunstkammern<br />
der Spätrenaissance. Man sammelte alles, was seltsam und fremd war.<br />
Auf diese Weise gelangten 1562 auch erstmals Tulpenzwiebeln nach Europa.<br />
John Trades cant (1570–1638), ursprünglich Gärtner des Herzogs von<br />
Buckingham, ist als eifriger Pflanzensammler bekannt und setzte eine botanische<br />
Völker wanderung in Gang. Auch das Sammeln und Klassifizieren<br />
bzw. das Einbalsamieren von ganzen menschlichen Körpern kam im 17. Jh. auf,<br />
womit ein zunehmendes anatomisches Wissen einherging. Eine solche<br />
Sammlerfigur, die unter anderem von der Ana tomie fasziniert war, war der<br />
russische Zar Peter der Grosse (1672–1725), der eine Vorliebe für lebendige<br />
Kleinwüchsige hatte und auch einen Hermaphroditen zu seiner kaiserlichen<br />
Sammlung zählte. Er war der erste grosse Sammler der russischen Geschichte,<br />
und es lässt einen beim Gedanken, dass er Passanten auf der<br />
Strasse Zähne zog, um diese dann zu sammeln, schaudern.<br />
Die Ordnung der Dinge<br />
Während im 16. und 17. Jahrhundert noch die Kuriositätenkabinette vorherrschend<br />
waren und sich dadurch auszeichneten, dass universal gesammelt<br />
wurde, war das 18. Jh. durch Systematik und spezialisierte Sammlungen geprägt.<br />
Carl Linné (1707–1778) gilt diesbezüglich als einer der be deutendsten<br />
Persönlichkeiten. Er stellte eine botanische Sammlung zusammen und schuf<br />
eine sexuelle Systematik des Pflanzenreiches. Die Ordnung der Dinge wurde<br />
nun relevant. Es ist auch im 18. Jh., als Sammlungen im Zuge der Auf klärung<br />
vermehrt dem Volk zugänglich gemacht wurden. Im 19. Jh. spriessen überall<br />
in Europa Museen und hatten einen missionarischen Zweck: Sie dienten der<br />
Propaganda der aufkommenden Nationalstaaten und sollten mithelfen, den<br />
Bürger zu formen und zu erziehen. Ab 1870 kam auch erstmals der Begriff<br />
des «Kitsch» auf, der von Münchner Kunsthändlern geprägt wurde, die Bilder<br />
in Malmanufakturen herstellten, um sie an englischsprachige Touristen zu<br />
«verkitschen». Sammeln wurde zur Konsumtätigkeit.<br />
Auf Diebestour<br />
Ein Sammler und zugleich einer der berühmtberüchtigtsten<br />
Kunstdiebe unserer Zeit hat wohl<br />
so manchem Kurator schlaflose Nächte bereitet:<br />
Stéphane Breitwieser stahl zwischen 1995 und<br />
2001 auf seiner Diebestour durch ganz Europa<br />
über 200 Kunstwerke im Gesamtwert von circa<br />
20 Mio. Euro. Diese verkaufte er nicht etwa, sondern<br />
sammelte sie zuhause. Den ersten Griff nach<br />
einem Gemälde beging er 1995 in der Schweiz,<br />
wo er auch 2001 nach einem Diebstahl gefasst<br />
wurde. Als Komplizinnen durfte er auf seine Mutter<br />
und seine Freundin zählen. Seine Mutter vernichtete<br />
offenbar einen Teil seines Diebesgutes und<br />
kassierte wie seine Freundin dafür ebenfalls eine<br />
Haftstrafe. Im Jahre 2006 erschien eine Autobiographie<br />
Breitwiesers mit dem Titel «Confessions<br />
d’un voleur d’art». Allerdings wurde der Elsässer<br />
2011 erneut gefasst, da er rückfällig geworden<br />
war. Er selbst begründete seine Vergehen mit<br />
einem Sammelzwang: «Ein Kunstsammler ist nur<br />
dann glücklich, wenn er das begehrte Objekt<br />
endlich besitzt. Aber dann will er etwas Neues,<br />
wieder und wieder, er kann einfach nicht aufhören.»<br />
Die Kulturgeschichte des Sammelns lehrt uns nicht<br />
nur, was wann und wie gesammelt wurde, sondern<br />
sie ist auch ein Spiegel unseres Selbst. Denn<br />
noch immer ist jedes Objekt, das wir sammeln,<br />
etwas, wonach wir uns sehnen, und das wichtigste<br />
Stück der Sammlung kommt erst noch.<br />
36 | <strong>PRESTIGE</strong><br />
«Wenn man<br />
ein Kenner ist,<br />
darf man keine<br />
Sammlung anlegen.»<br />
– Jean-Jacques Rousseau –