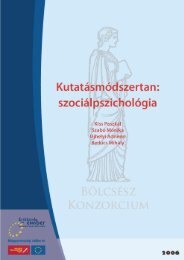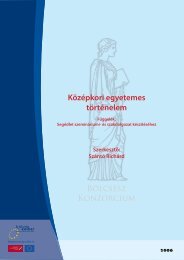Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schriftlichkeit <strong>und</strong> Mündlichkeit<br />
anführt <strong>und</strong> die noch heute in der Diskussion um Schriftlichkeit <strong>und</strong> Mündlichkeit<br />
nachklingen:<br />
Erstens die Feststellung, daß ein schriftlicher Text stumm ist, daß er den Leser, der<br />
über eine ihm nicht verständliche Stelle Auskunft haben möchte, im Stich läßt.<br />
Damit hängt zweitens zusammen, daß die Wahrheit sich nach Platons Vorstellung<br />
nicht auf eine einfache Aussage reduzieren läßt, die in eine einzige Satzfolge gefaßt werden<br />
kann. Er hält die Wahrheit für dialektisch, das heißt nur im Gespräch – in Rede<br />
<strong>und</strong> Gegenrede – erreichbar. Die Schrift schließt jedoch die Gegenrede aus. Daher ist<br />
ihre Wahrheit Scheinwahrheit. Wir finden dieses Argument auch in der Mitte des 20.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts wieder, wenn auch in leicht abgewandelter Form.<br />
Und drittens die These, daß die schriftliche Tradition zu einer Vielwisserei führe,<br />
während sich die mündliche Tradition auf das Wesentliche beschränke. Auch dieses<br />
Argument ist in die abendländische Literatur eingegangen.<br />
Wie Platon sich diese mündliche Tradition vorstellt, hat er in seinem Werk Die Gesetze<br />
ausgeführt, in dem er die Kreter lobt, daß sie keine Schrift besitzen. Sie hätten sie nicht<br />
nötig, da sie ihre Riten, Mythen <strong>und</strong> Gesetze in Versmaßen abgefaßt hätten, die leicht zu<br />
behalten seien.<br />
Mit dieser Aussage sind wir bereits in der aktuellen Diskussion um das Verhältnis<br />
von Schriftlichkeit <strong>und</strong> Mündlichkeit, oder wie dies im modernen Fachjargon heißt, von<br />
Literalität* <strong>und</strong> Oralität*.<br />
Der Gegensatz Schriftlichkeit <strong>und</strong> Mündlichkeit wurde lange Zeit als ein entscheidendes<br />
Unterscheidungskriterium für den <strong>Kultur</strong>zustand eines Volkes angesehen. Es<br />
zog die Grenze zwischen den <strong>Kultur</strong>völkern, die eine Schrifttradition besitzen, <strong>und</strong> den<br />
sogenannten Primitivvölkern ohne Schrift. Sowohl die Soziologie als auch die Ethnologie*<br />
haben die Existenz der Schrift zum Gr<strong>und</strong>kriterium für die <strong>Kultur</strong> gemacht, wobei<br />
unterstellt wurde, daß die schriftlosen Völker auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe<br />
stünden <strong>und</strong> durch Übernahme einer Schrift zu einer höheren kulturellen Stufe aufsteigen<br />
müßten.<br />
Ein erster Anstoß zu einer Neubewertung schriftloser <strong>Kultur</strong>en ging von einer<br />
linguistischen Untersuchung der Dichtungen Homers aus, die der englische Altphilologe<br />
Hilman Parry 1928 veröffentlicht hat. Er glaubte aufgr<strong>und</strong> der speziellen Struktur<br />
dieser Epen annehmen zu können, daß diese Werke in den ersten Jahrh<strong>und</strong>erten ihres<br />
Bestehens nicht aufgezeichnet, sondern nur mündlich überliefert wurden. Dabei handelt<br />
es sich bei den beiden Homerischen Epen jeweils um Texte mit mehreren tausend Versen.<br />
Parry stützt seine These auf die Beobachtung, daß in den Epen einige feste Formulierungen<br />
immer wiederkehren, die er als typische Gedankenstützen in einer mündlichen<br />
Überlieferung interpretiert. Inwieweit diese Annahme richtig ist, bleibt auch heute<br />
noch unter den Fachleuten umstritten. Daß derartige stereotype Wendungen auf mündliche<br />
Traditionen hinweisen, haben Ethnologen* in den sechziger Jahren dieses Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
an mündlich überlieferter Literatur in Serbien belegen können. Doch gibt es auch Gegenbeispiele,<br />
zum Beispiel in der spätbabylonischen Literatur. Der Verfasser des Erra-Epos,<br />
27