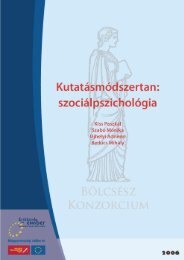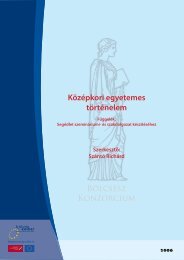Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schriftlichkeit <strong>und</strong> Mündlichkeit<br />
sprachen. Es gibt Beispiele dafür, daß eine Schrift nur für bestimmte Lebensbereiche übernommen<br />
<strong>und</strong> nach einer gewissen Zeit wieder abgestoßen wurde. So hat z.B. die mykenische<br />
<strong>Kultur</strong> auf dem griechischen Festland im 13. Jahrh<strong>und</strong>ert vor Christus aus Kreta<br />
zur Aufzeichnung wirtschaftlicher Daten eine Schrift, die sogenannte Linear B übernommen,<br />
die in der dorischen Wanderung um 1000 vor Christus wieder unterging. Wie Stellen<br />
bei Herodot <strong>und</strong> Platon zeigen, gab es im klassischen Griechenland auch keine Erinnerung<br />
mehr an diese Schrift. Ähnliches läßt sich für einige Inseln der Philippinen nachweisen.<br />
Dort wurde im Zusammenhang mit der buddhistischen Religion eine Schrift aus Indien<br />
übernommen, die sich später wieder bis auf wenige Reste bei dem Volksstamm der Manguyan<br />
verloren hat. Diese Beispiele zeigen schon, daß es keine geradlinige <strong>Kultur</strong>entwicklung<br />
von den sogenannten Naturvölkern zu den <strong>Kultur</strong>völkern gibt. Die Schriftentwicklung<br />
<strong>und</strong> Schriftausbreitung stellt sich vielmehr als ein sehr komplexer Vorgang<br />
dar.<br />
Was bedeutet es jedoch, wenn ein Volk von einer mündlichen zu einer schriftlichen<br />
Kommunikation übergeht? Wie Beispiele zeigen, löst dieser Übergang bei vielen Menschen<br />
Ängste aus. So wenden sich Menschen in illiteralen* Gesellschaften gegen die Verschriftlichung<br />
ihrer Sprache einschließlich ihres mündlich überlieferten Erzählguts. Das<br />
vielleicht deutlichste Beispiel eines Volkes, das seit vielen Jahrh<strong>und</strong>erten in einem engen<br />
Kontakt mit literalen Gesellschaften lebt, ohne selbst eine Schrift entwickelt oder eine<br />
fremde Schrift übernommen zu haben, sind die Zigeuner. Sie wehren sich noch immer<br />
dagegen, daß ihre Traditionen aufgezeichnet werden. Und auch von afrikanischen Völkern<br />
berichten Ethnologen ähnliche Ängste, daß man mit der Verschriftlichung ihnen ihre<br />
Sprache <strong>und</strong> damit ihre Identität raube.<br />
Ohne jeden Gr<strong>und</strong> bestehen derartige Ängste nicht. Denn mit der Übernahme der<br />
Schrift sterben nicht nur literarische Überlieferungsformen ab, z.B. die der berufsmäßigen<br />
Erzähler, der Rhapsoden im alten Griechenland oder der Riots in einigen afrikanischen<br />
<strong>Kultur</strong>en – <strong>und</strong> dies wird wohl zu Recht als eine kulturelle Verarmung empf<strong>und</strong>en.<br />
Es ändert sich auch die Sprachstruktur, da die Verschriftlichung von Reden,<br />
von Gesagtem, tief in die Sprache eingreift. Die mündliche Sprache ist in aller Regel<br />
konkreter im Ausdruck. Sie enthält weniger Abstrakta – <strong>of</strong>t gar keine – <strong>und</strong> bevorzugt<br />
eine stärker personen- <strong>und</strong> situationsbezogene Ausdrucksweise.<br />
Die Sprache wird bei ihrer Verschriftlichung stärker wortbestimmt. Die mündliche<br />
Tradition der sprachlichen Mitteilung beruht darauf, daß Wortbilder, sogenannte Ideophone,<br />
vermittelt werden. Es handelt sich dabei um Sinnzusammenhänge, die Anschauliches<br />
wiedergeben, z.B. Sprichwörter; Parabeln oder charakteristische Wendungen. Einen<br />
gewissen Eindruck von der Wirkung derartiger Ideophone vermitteln uns noch stereotype<br />
Wendungen, wie sie uns etwa aus Märchen bekannt sind, Textfolgen wie „Du mußt es<br />
dreimal sagen”. Sie verleihen der mündlichen Darstellung eine feste Struktur, die nicht<br />
nur bei der Textüberlieferung als Gedächtnisstütze dienen kann, sondern auch eine Hilfe<br />
für das Verständnis des Textes durch den Rezipienten ist.<br />
Doch über den linguistischen Aspekt hinaus greift die Verschriftlichung auch in die<br />
soziale Struktur einer Gesellschaft ein. Orale Gesellschaften haben eine feste Sozial-<br />
29