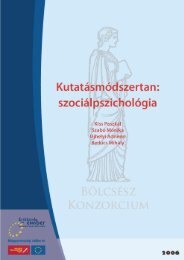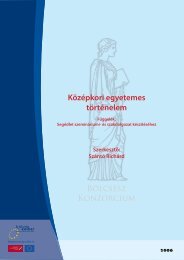Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft III. - Index of - Eötvös ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschichte der Fotografie 63<br />
benso wie der Dominikanermönch <strong>und</strong> Gelehrte Albertus Magnus im Mittelalter. Doch<br />
erst Leonardo da Vinci schuf die Voraussetzungen dafür, daß dieses Phänomen praktisch<br />
anwendbar wurde. Daß aber seine wichtigen Entdeckungen von 1490-1492 noch mehrere<br />
Jahrh<strong>und</strong>erte folgenlos blieben, lag daran, daß er seine Aufzeichnungen in einer Art Spiegelschrift<br />
verfaßte, die erst 1797 entschlüsselt werden konnte. Auch andere Gelehrte <strong>und</strong><br />
Wissenschaftler wie G. della Porta, J. Kepler oder A. Kircher widmeten sich dieser Erscheinung.<br />
Anfangs war die Camera obscura wirklich eine begehbare, verdunkelte Kammer<br />
mit einem Loch in der Außenwand, die Künstlern als Zeichenhilfe diente. Im Laufe<br />
des 17. Jh. konstruierte man dann kleine, kastenförmige, mit Linsen versehene Apparate,<br />
in deren Innerem Umkehrspiegel angebracht waren. Sie lenkten die Bilder<br />
auf eine Glasplatte, die sich an der Oberseite des transportablen Kastens befand,<br />
<strong>und</strong> von dem Zeichner dann das Bild abpausen konnte. J. Zahn beschrieb <strong>und</strong> zeichnete<br />
1685 wohl als erster so einen transportablen Kasten.<br />
Auch die Entwicklung konkaver <strong>und</strong> konvexer optischer Linsen war zu Beginn des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts so weit vorangeschritten, daß der Münchner J. v. Fraunh<strong>of</strong>er mit der erstmaligen<br />
Berechnung achromatischer Linsen <strong>und</strong> einer Methode zur Bestimmung der Brechungszahlen<br />
von Gläsern den vorläufigen bahnbrechenden Höhepunkt, die Feinoptik<br />
setzte. Die Optik hatte zu dieser Zeit alle wesentlichen Voraussetzungen geschaffen, so<br />
daß nun das Herstellen geeigneter Glassorten, das Bearbeiten der Linsen <strong>und</strong> das Fassen<br />
der verschiedenen Linsenkombinationen in den Vordergr<strong>und</strong> rückten.<br />
Bevor die Fotografie ihren Siegeszug begann, traten eine Reihe optischer Geräte neben<br />
die Camera obscura, die dem Bedürfnis nach Naturnachahmung Rechnung tragen<br />
sollten. Allen voran war es die Laterna magica*, deren Ursprung bis ins 17. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zurückreicht. Durch Ausnutzung einfacher optischer Gesetze konnte man mit ihr ein<br />
transparentes Bild, das durchleuchtet wurde, auf eine Fläche projizieren. Die Laterna<br />
magica war in gewisser Weise ein Vorläufer des modernen Dia-Projektors. Nur wurden<br />
ihre Bilder bis in die 70er Jahre des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts gemalt.<br />
Der beispiellose Bilderbedarf des sich emanzipierenden Bürgertums ließ auch den<br />
Silhouettenschnitt außerordentlich populär werden. Vom Schneider wurde dabei einzig<br />
die Fähigkeit verlangt, einen Schatten nachzeichnen <strong>und</strong> ihn ausschneiden zu können.<br />
Und auch das 1786 von G.-L. Chrétien entwickelte Physionotrace* erforderte kein hohes<br />
zeichnerisches Vermögen. Es hatte den Vorteil, daß es Miniaturen lieferte, die als Kupferdruckvorlagen<br />
zur Vervielfältigung geeignet waren. Ein weiteres Hilfsmittel, um mangelndes<br />
zeichnerisches Talent auszugleichen, war die 1807 von dem Engländer W.H.<br />
Wollaston erf<strong>und</strong>ene Camera lucida*. Mit ihr stellte auch W.H.F. Talbot zahlreiche Zeichenversuche<br />
an. Alle diese optischen Hilfsmittel dienten gewissermaßen dazu, auf<br />
billigere <strong>und</strong> schnellere Weise Bilder, insbesondere Porträts, zu produzieren, um der<br />
steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Sie beeinflußten nicht nur die Ästhetik jener<br />
Zeit, sondern stellten auch die Auffassung vom genialischen Künstlersubjekt in Frage.<br />
Waren die Laterna-magica-Projektionen schon eine Form der Wirklichkeitsillusion,<br />
so bemühte man sich beim Panorama <strong>und</strong> Diorama um eine noch perfektere Nachahmung<br />
der Wirklichkeit. Beide gehörten seit Beginn des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zu den sehr po-